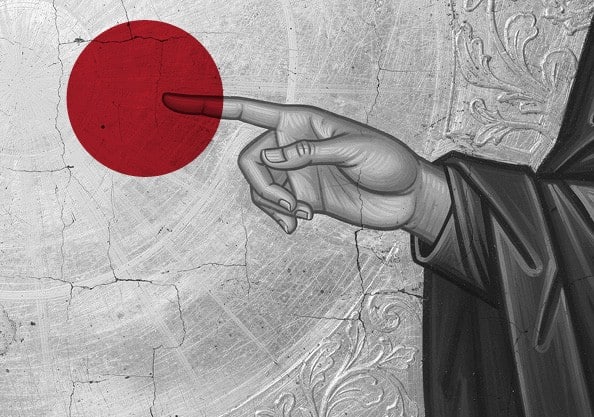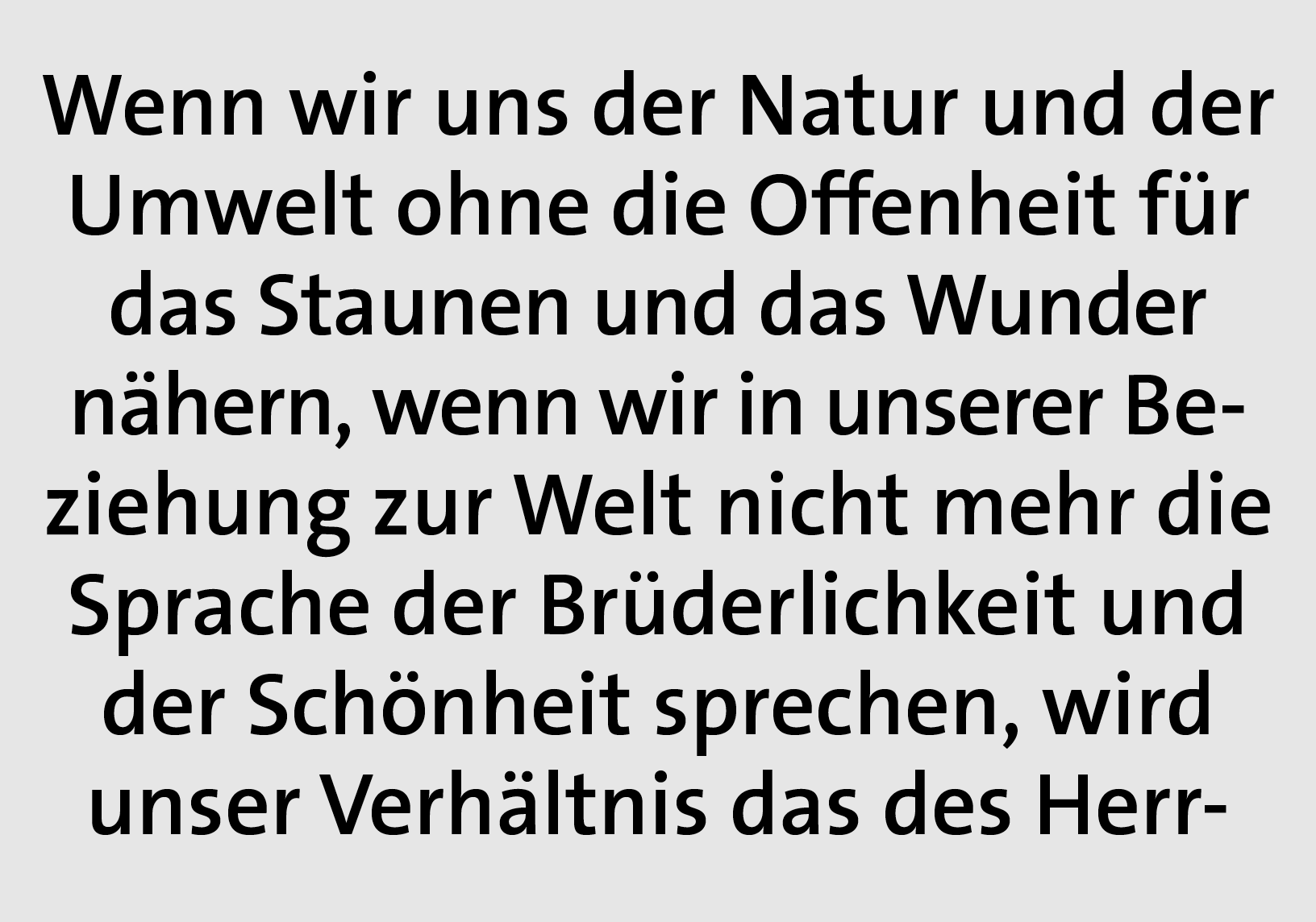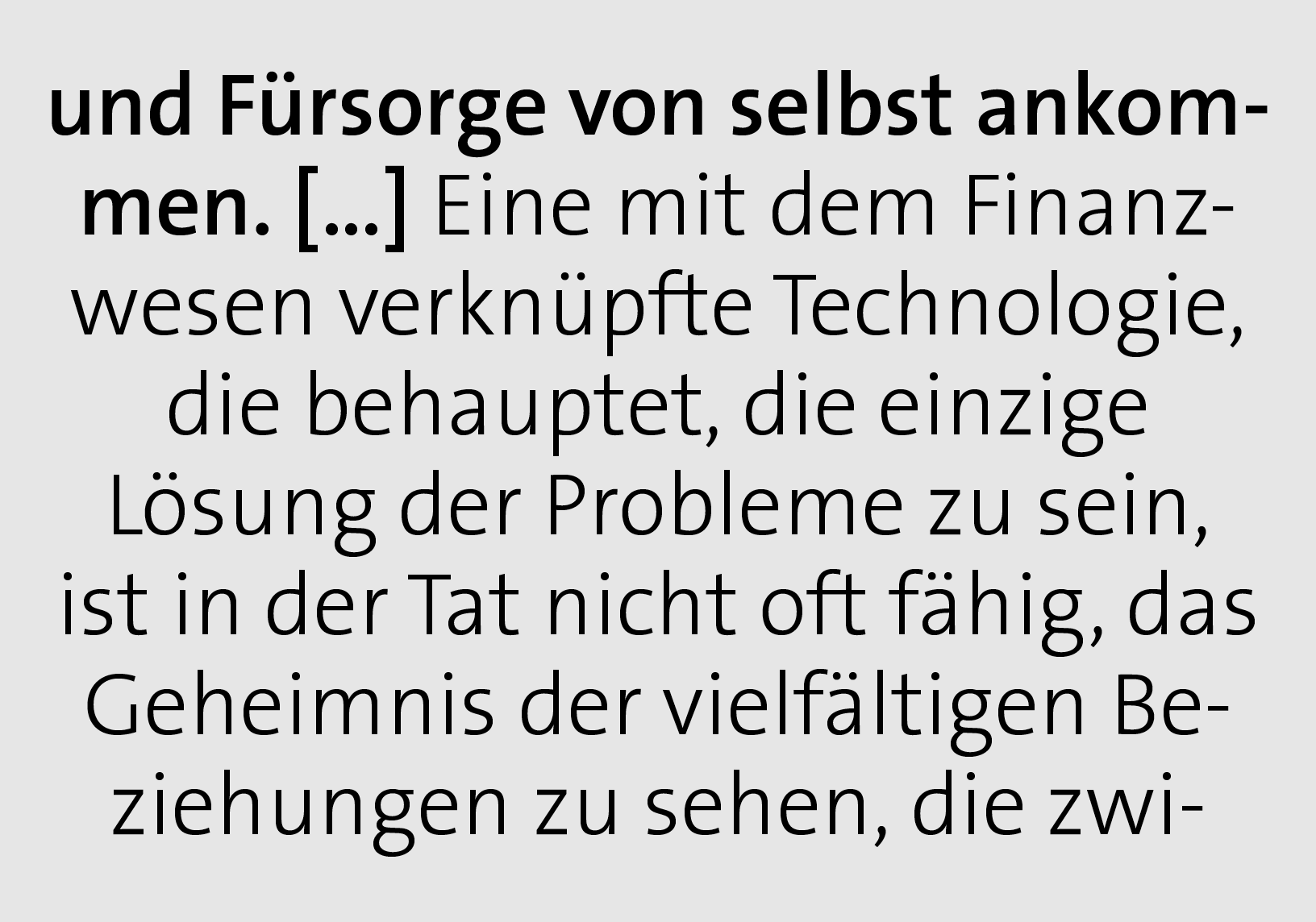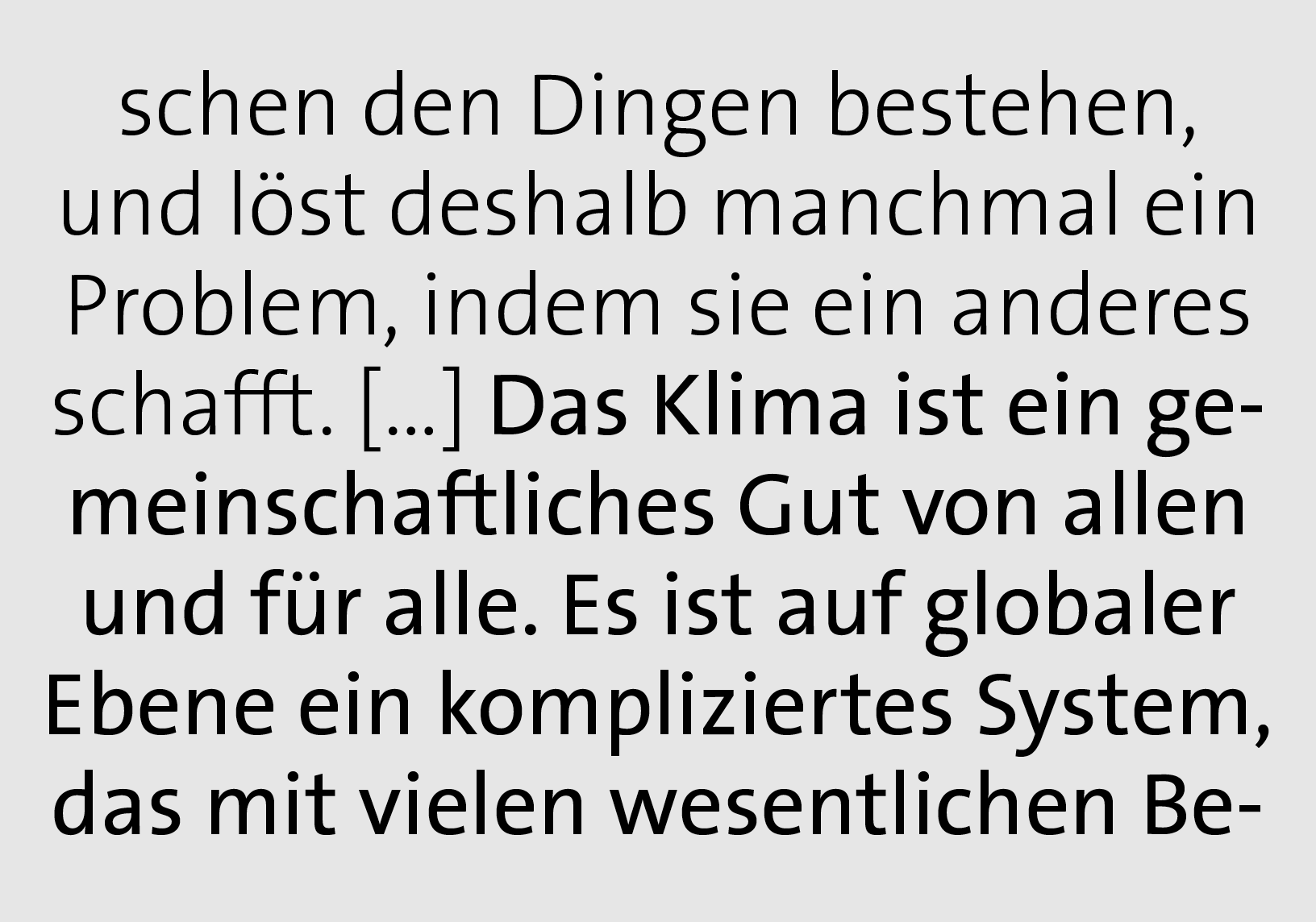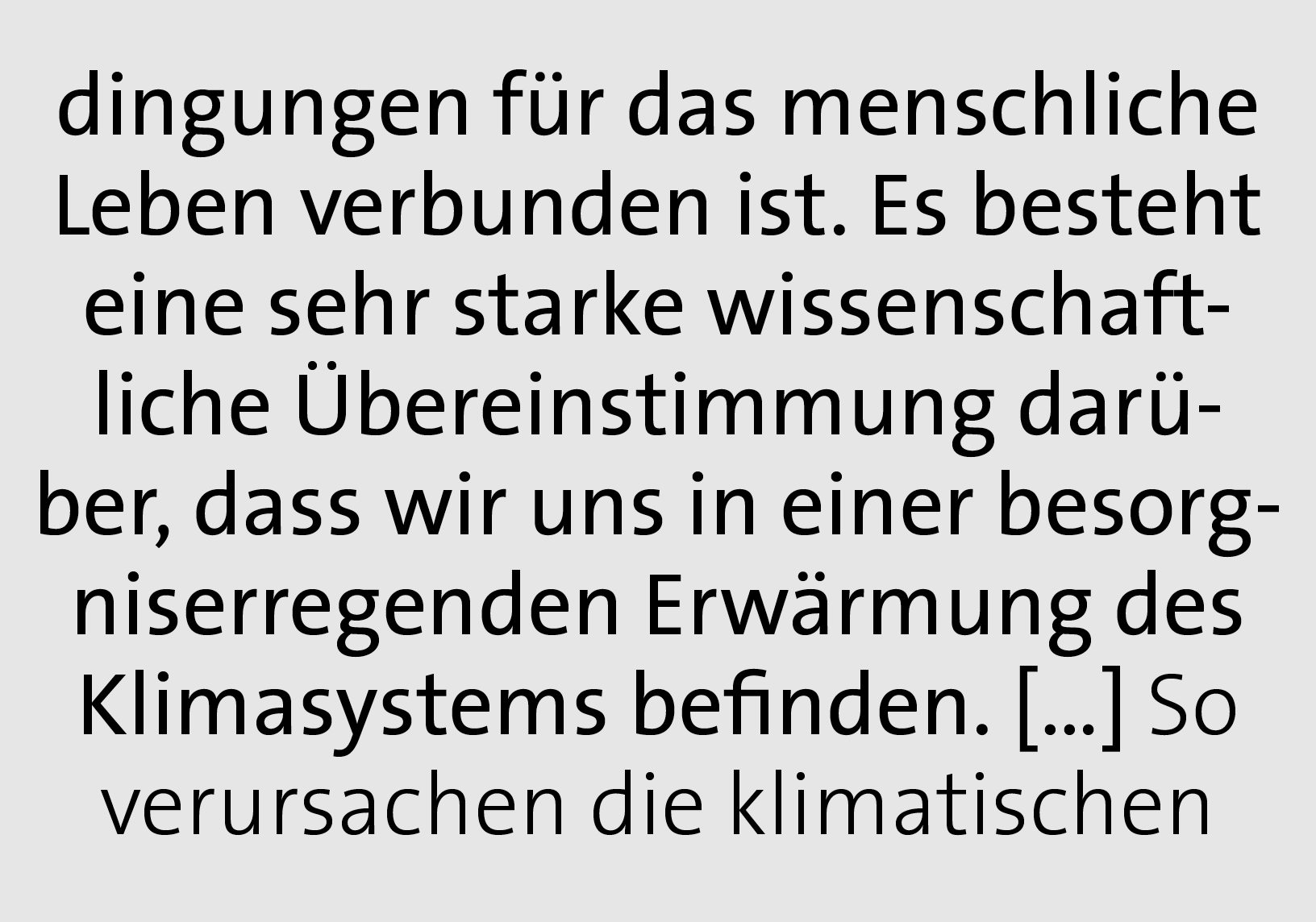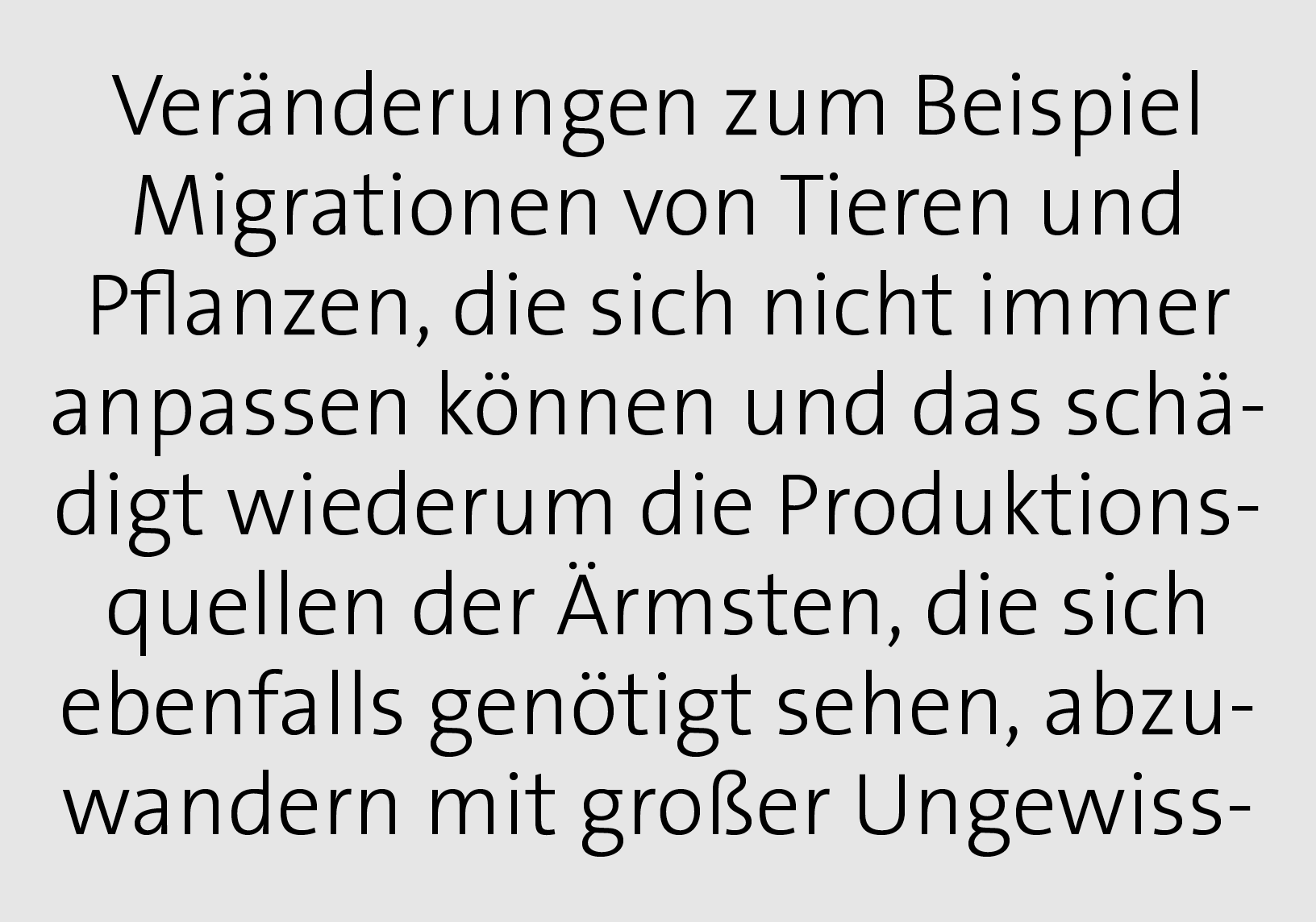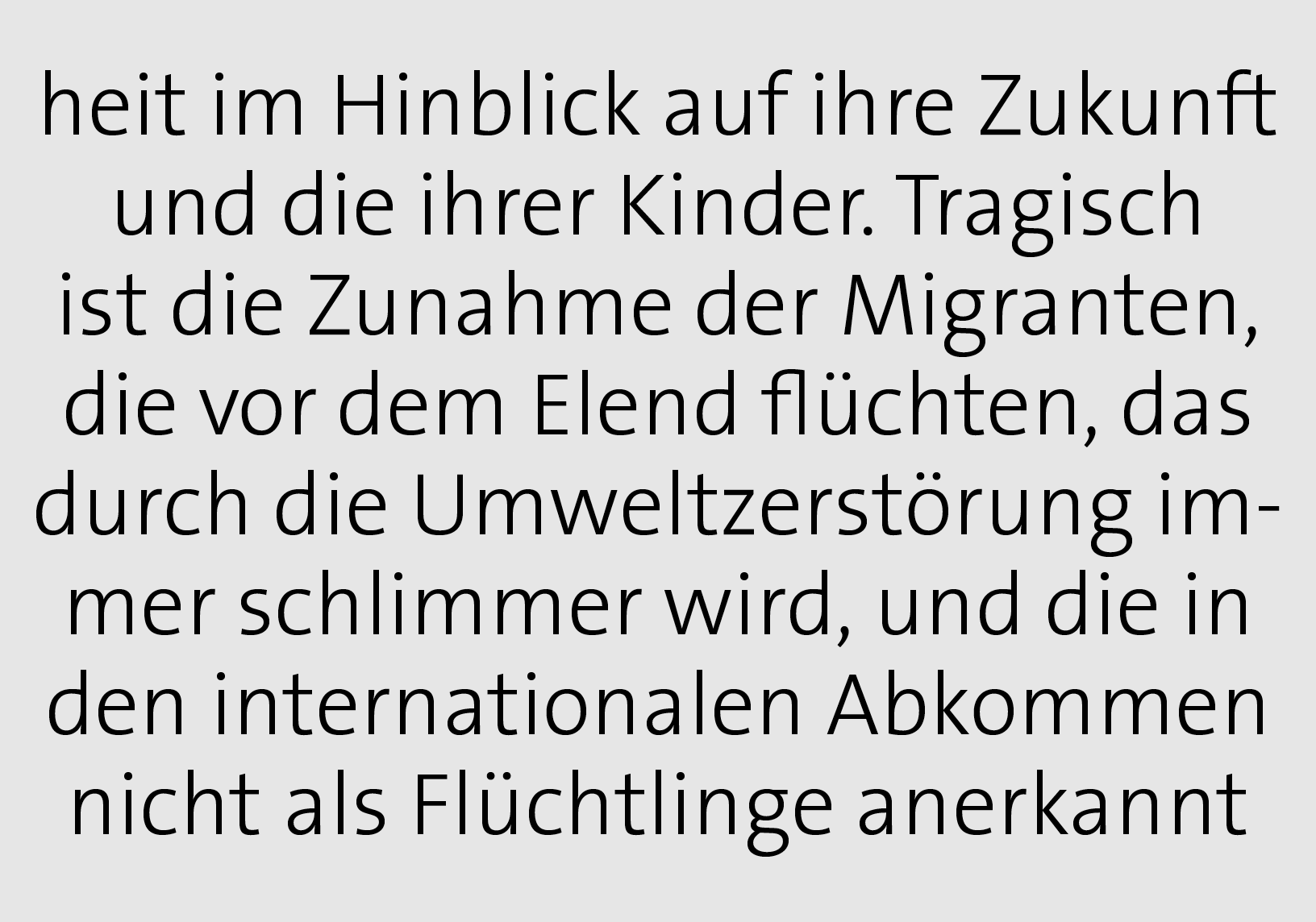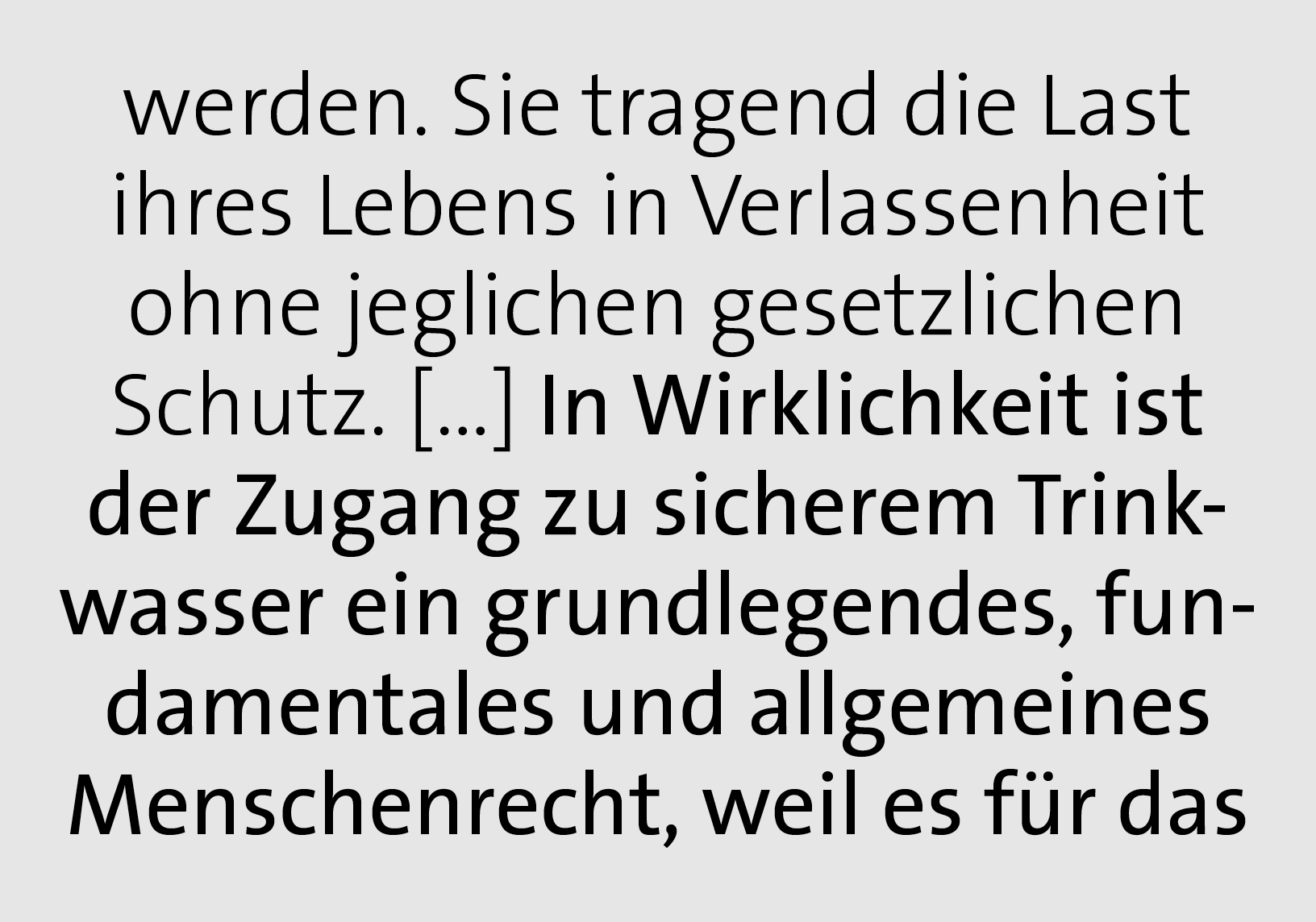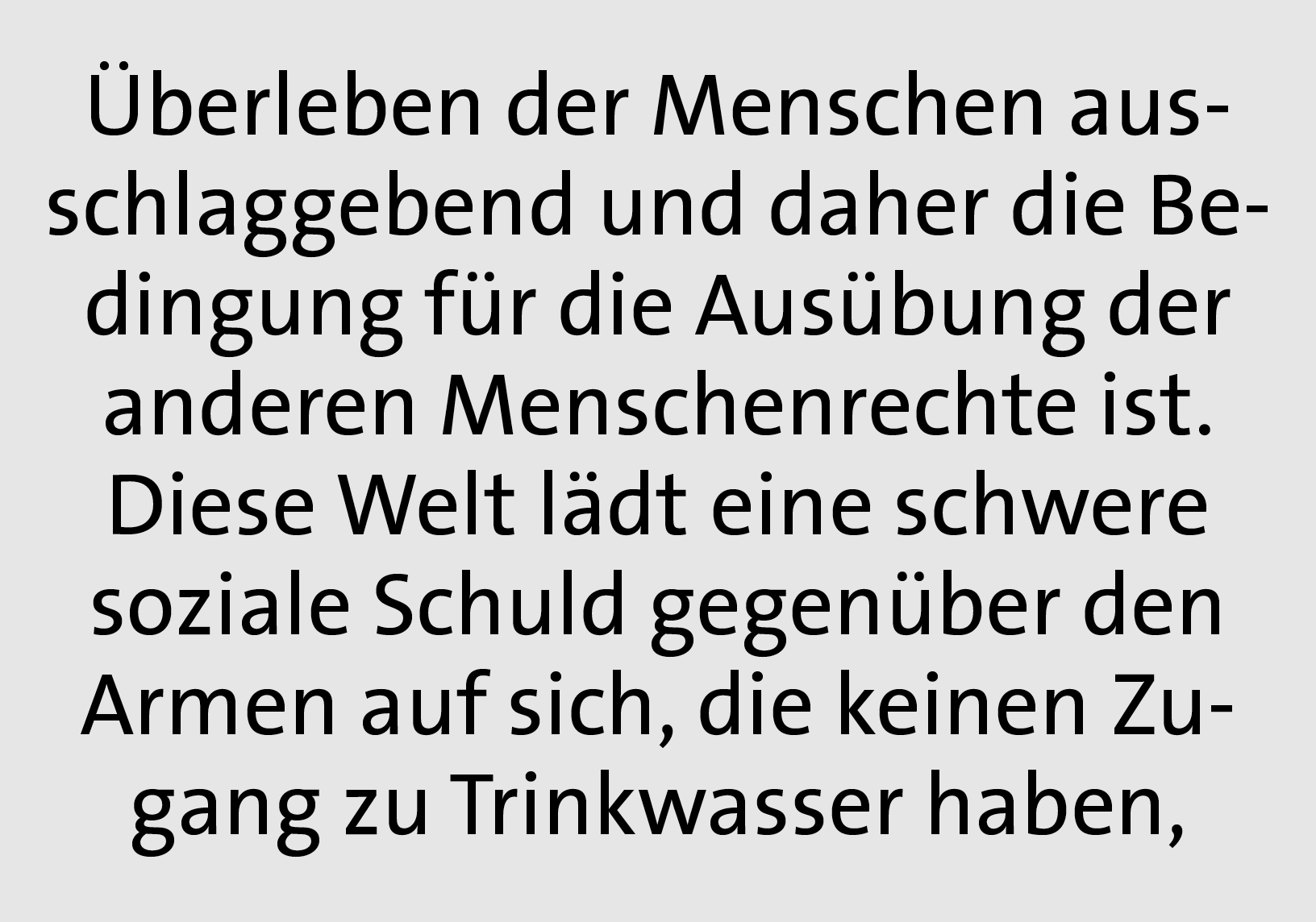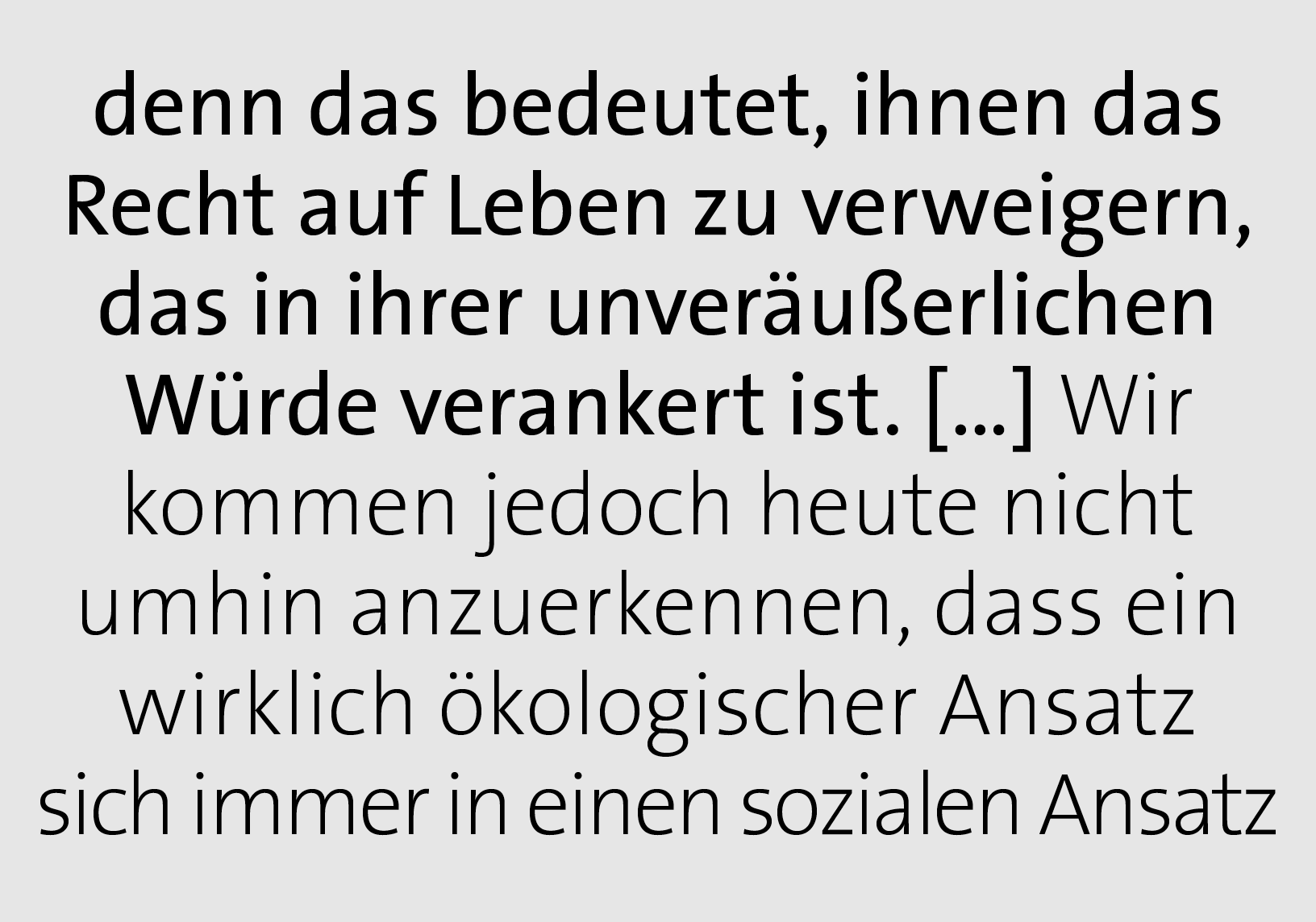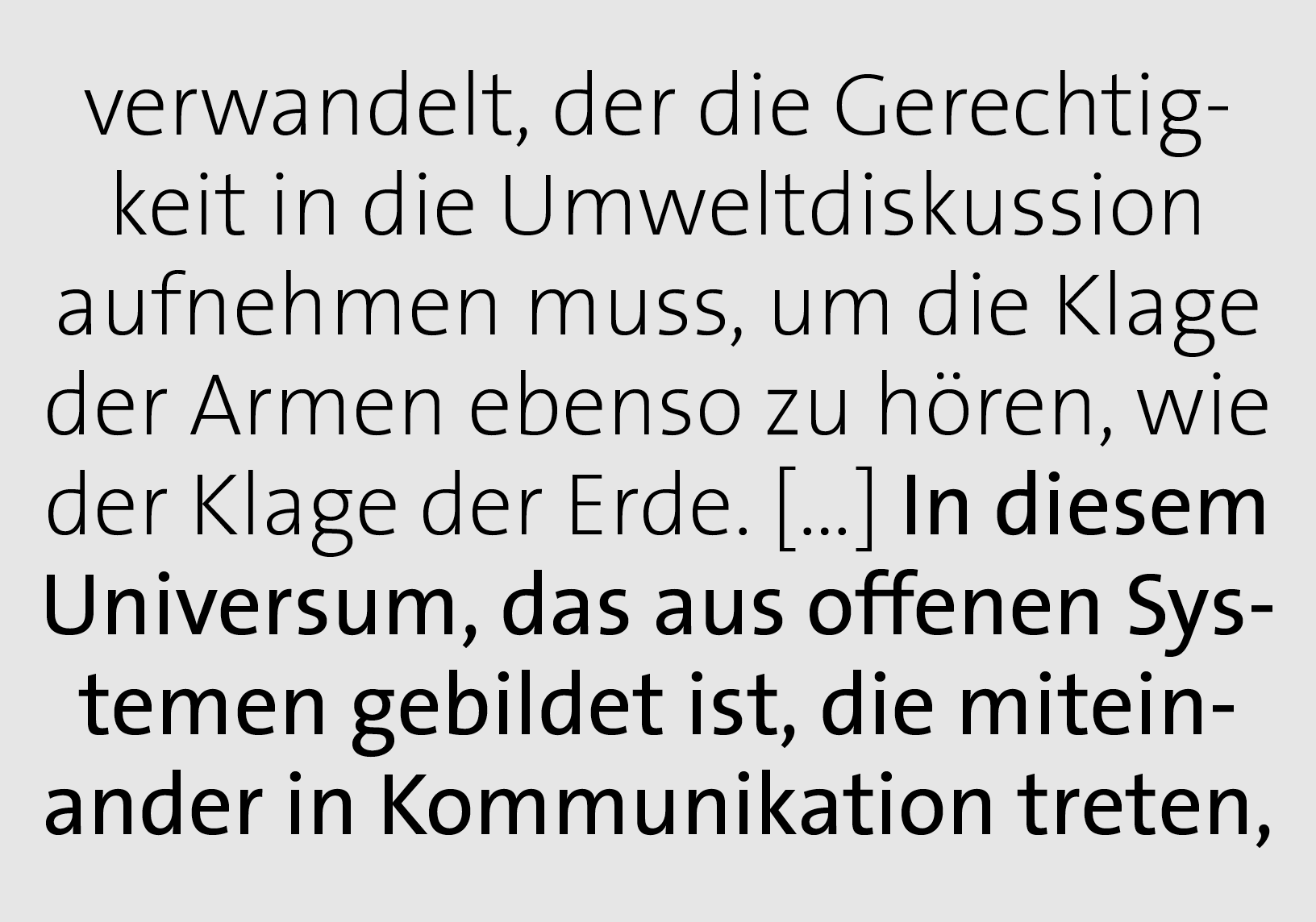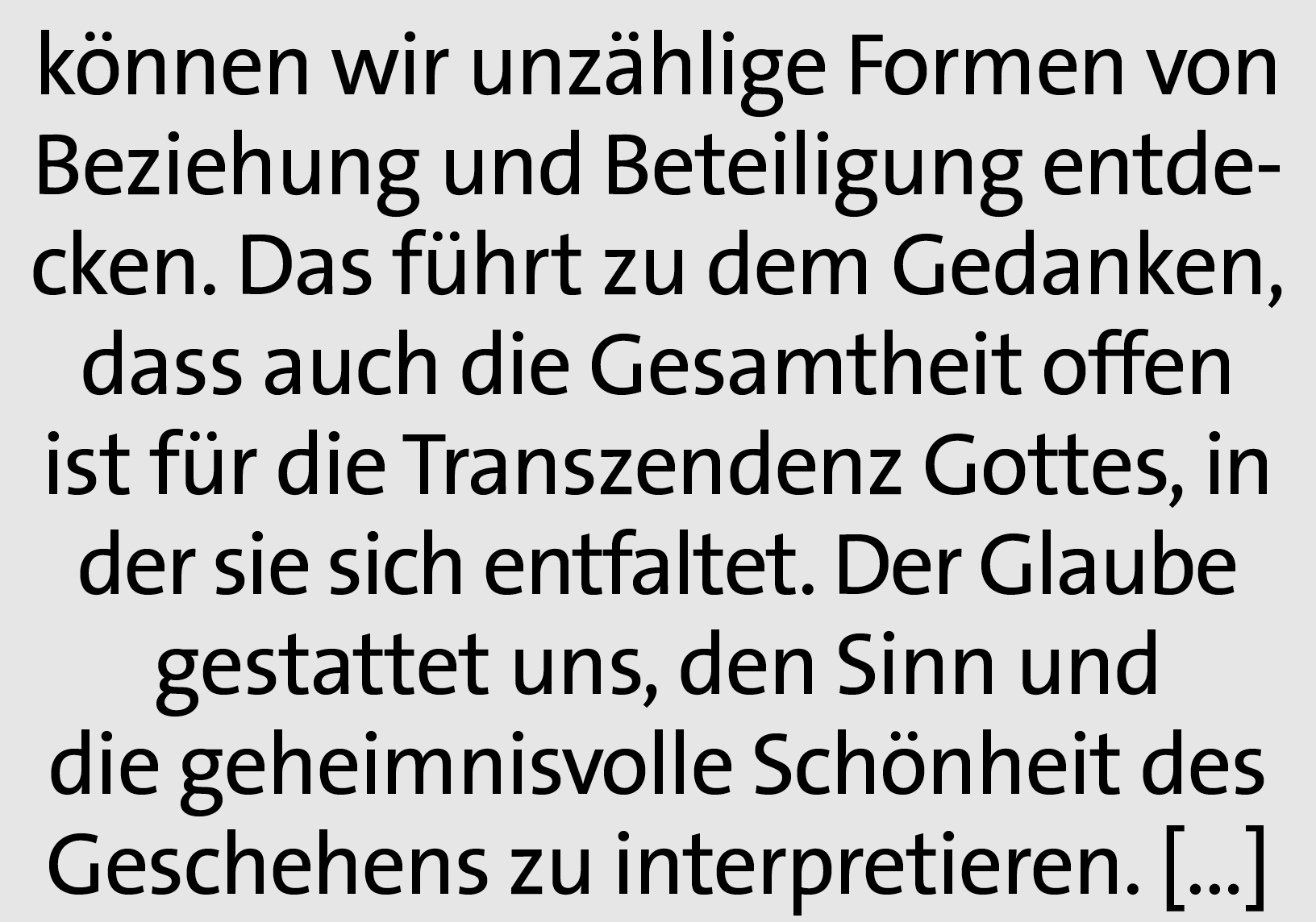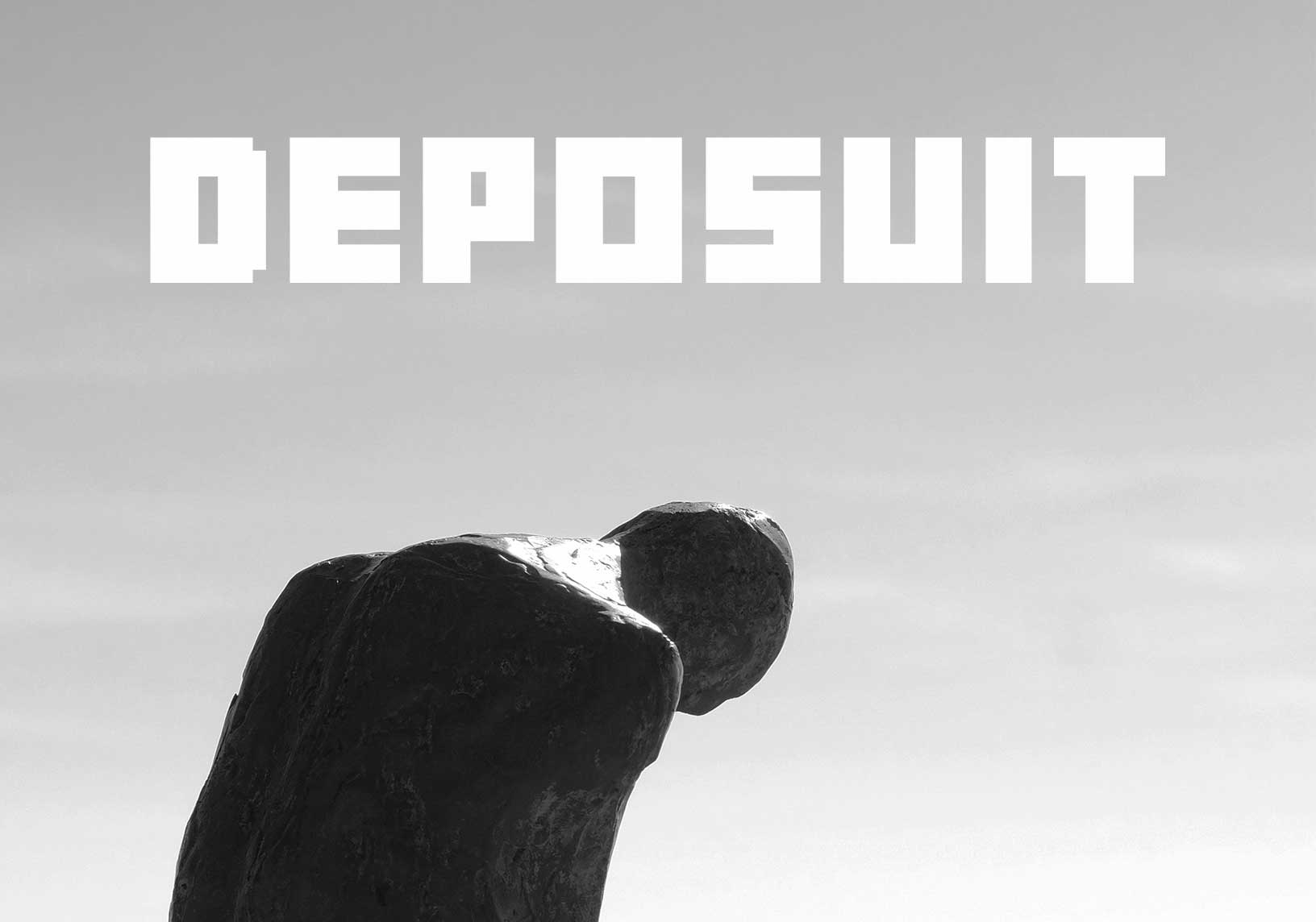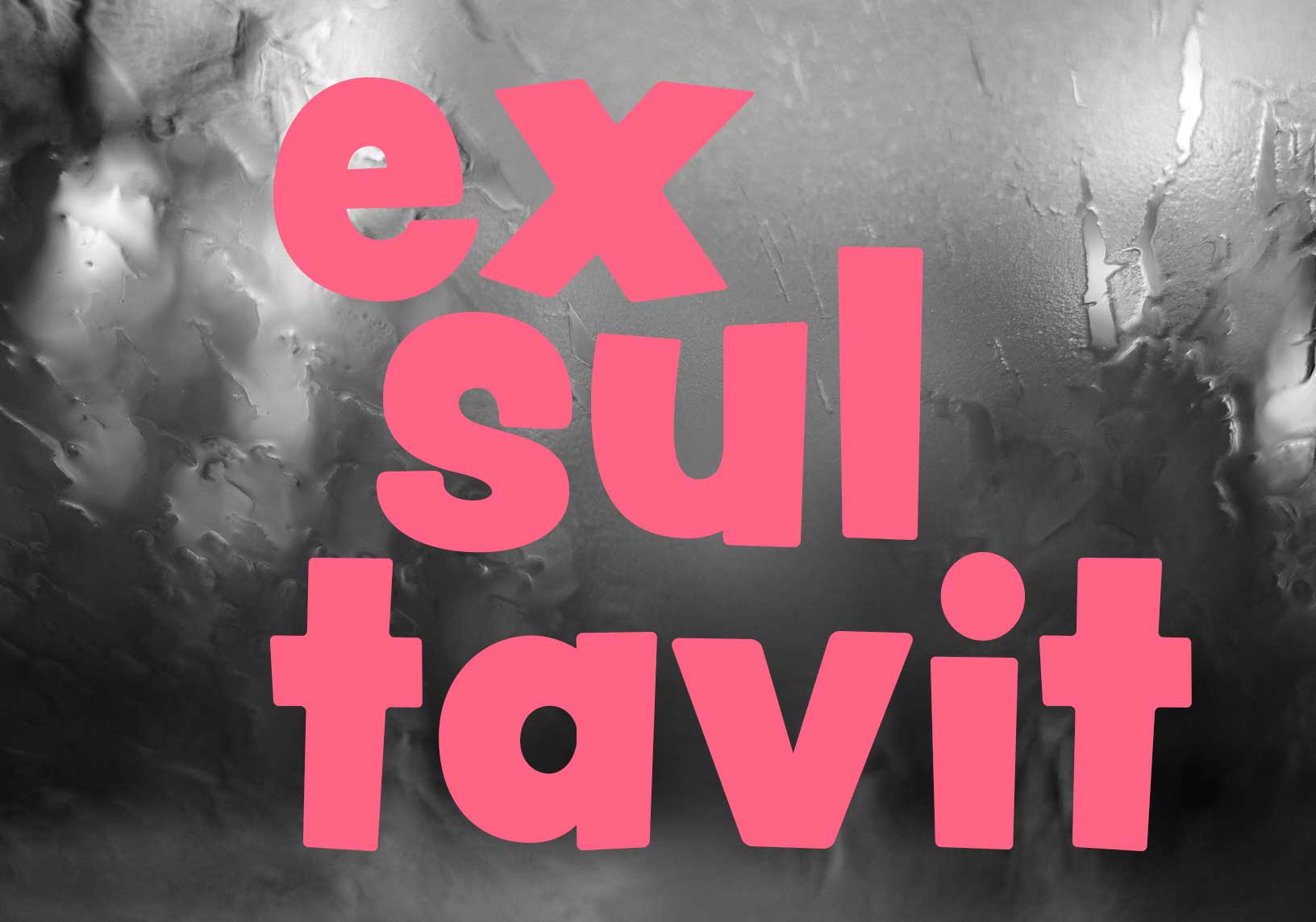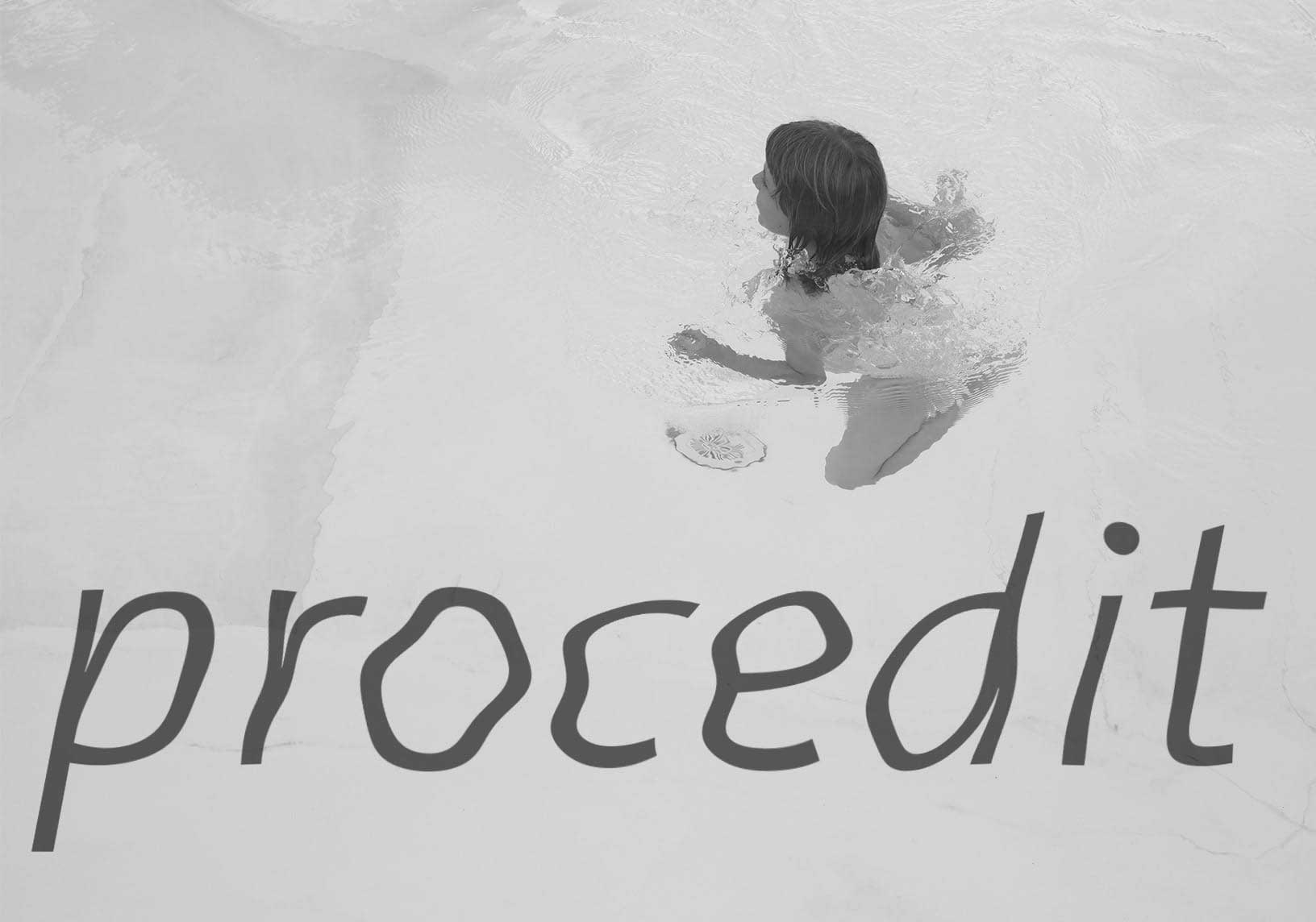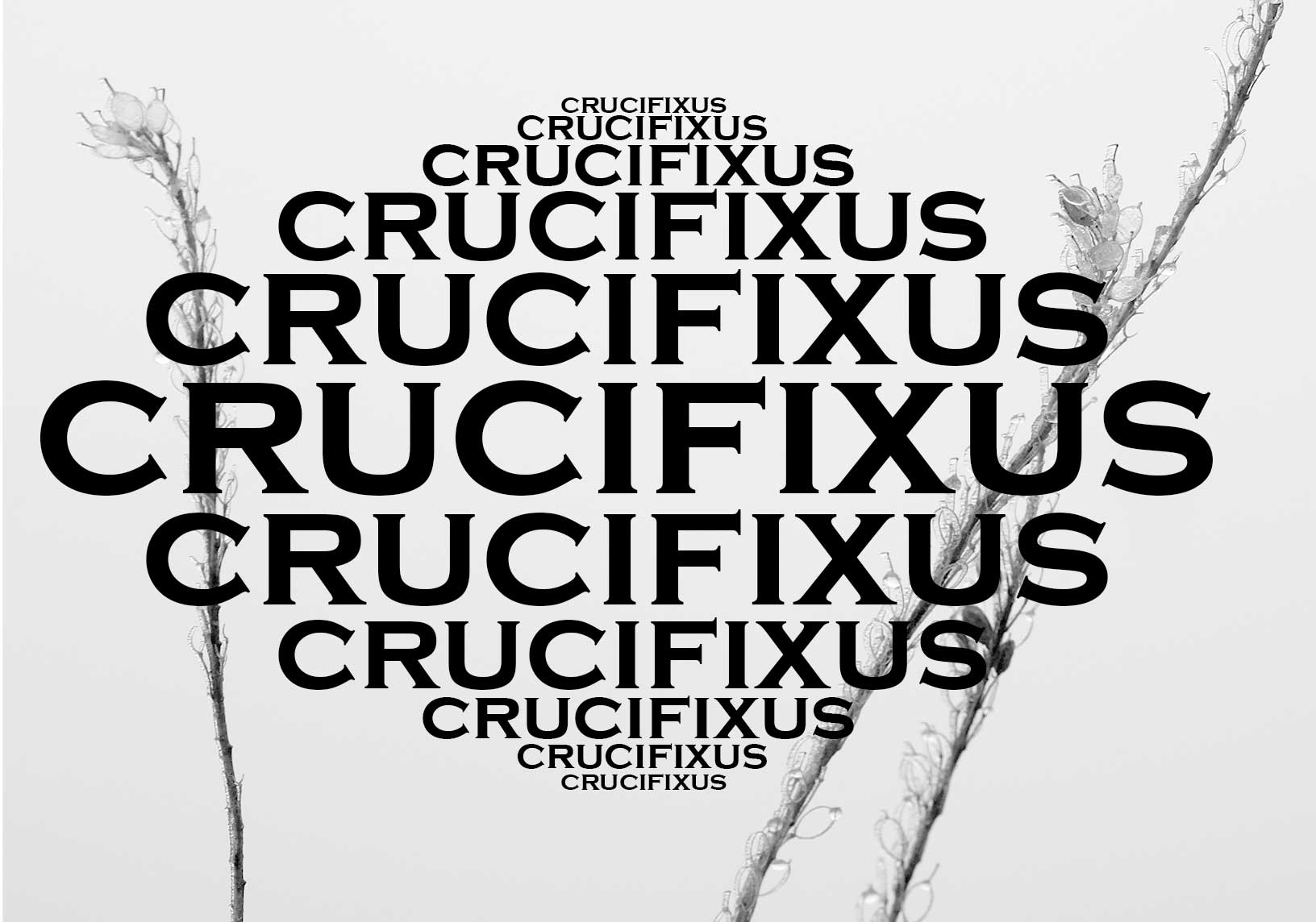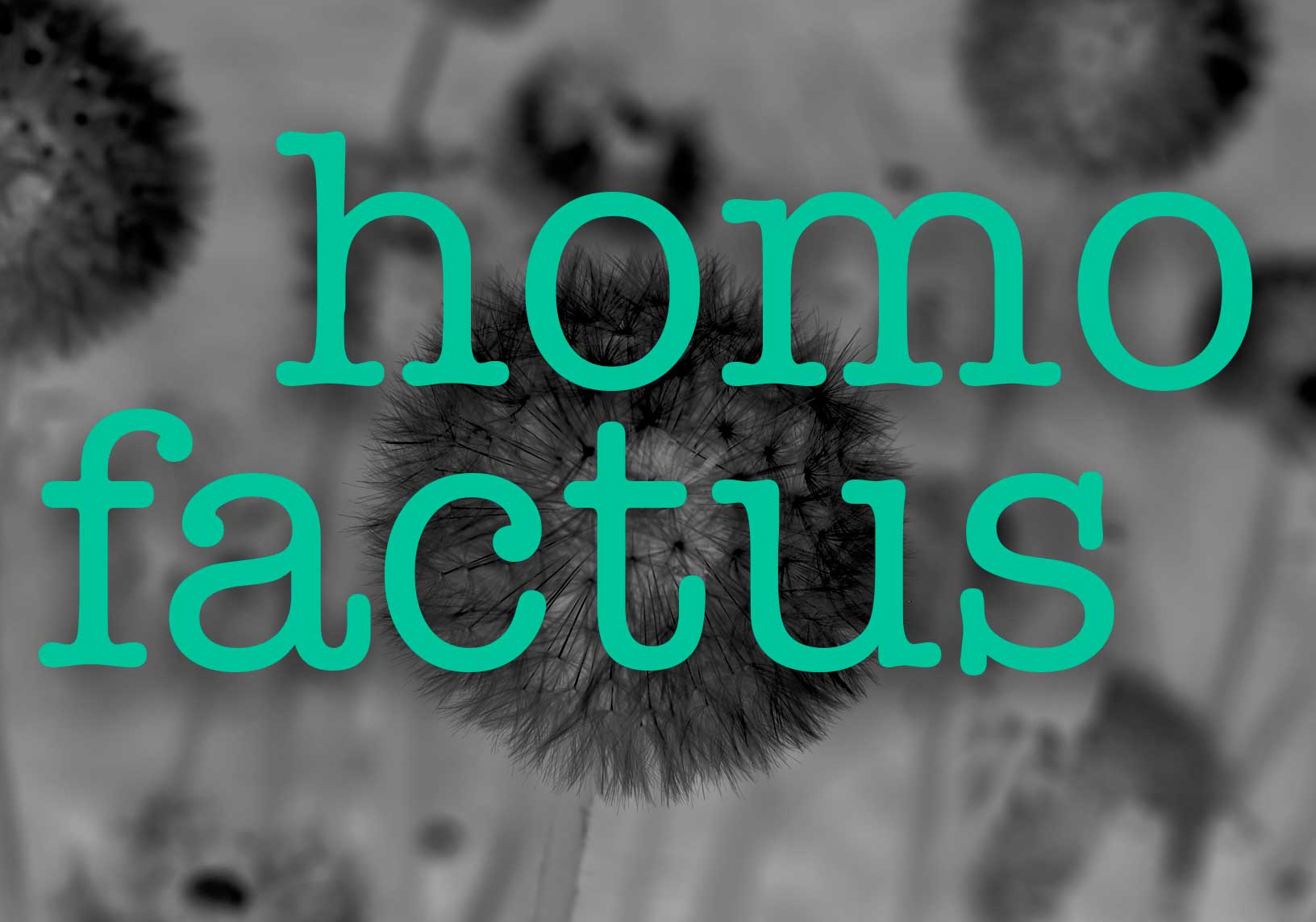Unterwanderungen – ein Blog von Dietrich Sagert
-
Untergrund // Die Ikone der Dreifaltigkeit von Andrej Rubljow
Die andere Seite des Exils war die Situation der Kirche in Russland bzw. der Sowjetunion selbst. In kaum einem anderen Land des sogenannten Ostblocks wurde die Kirche mit einer derartigen Härte verfolgt. Mit unterschiedlichen politische Strategien, setzt sich diese Verfolgung bis heute fort. Aber wie zum Trotz tritt eine weitere Praxis hinzu: der Untergrund.
-
Paul Evdokimov: Zur Einführung // Ikone der Verklärung
Angesichts seines Buches „Die Kunst der Ikone“ (1970) – aus dem in diesem Jahr an dieser Stelle einige Texte vorgestellt werden sollen – könnte man den russisch-orthodoxen Exilstheologen Paul Evdokimov einen „Zeugen der Schönheit Gottes“ nennen. Wenn man sie mit seinem Leben verbindet, liegt darin in Anbetracht der aktuellen Situation in Russland und Europa etwas…
-
Responsivität – dying son, dying earth
Zu Beginn der Lektüren von „Laudato si‘“ in diesem Blog stand die Überzeugung Bruno Latours, die er als eine enorme Chance ansah: „Die Theologie kann zu ihrer Tradition zurückkehren, zu einem Gott, der Mensch wurde, der zur Erde, zur Schöpfung gehört. Er nimmt an der Schöpfung teil, er ist Zeuge und Betroffener aller Entwicklungen.“ Zum…
-
Responsorien/ Antworten
„Nehmen wir eine Anthropologin, die es sich in den Kopf gesetzt hätte, das Wertesystem der ‚westlichen Gesellschaften‘ zu rekonstruieren – ein Terrain dessen genaue Abgrenzung in diesem Stadium nicht so wichtig ist“ und orientieren sie auf unsere Lektüren von „Laudato si‘“…
-
Antiphon/Gegenstimme: „Wenn wir Bücher besäßen…“
„Wenn wir Bücher besäßen, so wie sie, dann könnten die Weißen feststellen, wie alt diese Worte wirklich sind! Im Wald sind wir, die Menschen, die Ökologie! Aber genauso wie wir sind die xapiri, das Wild, die Bäume, die Flüsse, die Fische, der Himmel, der Regen, der Wind und die Sonne Ökologie! Sie umfasst alles, was…
-
Die Erfindung des Naturalismus
Die Art und Weise wie wir im modernen Westen die Dinge sehen hat sich im frühen Griechenland entwickelt, als die Menschen feststellten, dass nicht alles, was sie umgibt, von den Launen der Götter abhängt und durch sie entsteht. Vieles ließ sich aus sich selbst heraus, also aus der Erkenntnis der physischen Eigenschaften der beteiligten Phänomene…
-
Animismus?
Wenn der brasilianische Anthropologe Edouardo Viveiros de Castro die größte Herausforderung für die christliche Theologie angesichts des Klimawandels in der Frage danach zuspitzt, ob sie den Animismus reaktivieren könnte, so ist dies nur auf den allerersten und flüchtigen Bick eine Provokation, die ans Unvorstellbare grenzt. Warum also ausgerechnet Animismus?
-
Eine agnostische Lektüre
Ausgehend von seinen Erfahrungen als Anthropologe, der die Kosmologien der Indigenen des Amazonas erforscht, beschreibt der Brasilianer Edouardo Viveros de Castro seine Lektüre der Schrift „Laudato si‘“ als eine agnostische Lektüre. Sein Ausgangspunkt nach Analyse der realen Zustände in Brasilien ist folgender: „Genozid, Ethnozid und Ökozid, alle drei im Gange und alle drei im Namen…
-
Eine ökofeministische Perspektive
Bei Ihrer Lektüre der Enzyklika „Laudato si‘“ ist die französische Philosophin Émilie Hache vor allem erstaunt darüber, wie wenig sich die Kirche darin auch selbst in Frage stellt. Der Text konstatiert den alarmierenden Zustand der Welt, der gekennzeichnet ist vom raubtierhaften und extrem egoistischen Verhalten des Menschen ihr gegenüber und beschreibt die „menschliche Wurzel der…
-
Terrestrische Spiritualität
Der Frage danach, wie konkret die „enorme Chance“ für das Christentum genutzt und in welchen Bahnen sie gedacht werden könnte, ist Bruno Latour nicht ausgewichen. In Kooperation mit dem Collège des Bernardins – einer Art katholischer Akademie – in Paris unter Mitarbeit von weiteren Institutionen, wurde für die Jahre 2021-2023 ein Lehrstuhl „Laudato si‘“ eingerichtet und verschiedene…
-
Eine enorme Chance
Kurz vor seinem Tod im Oktober 2022 führte der französische Soziologe Bruno Latour eine Serie von kurzen Gesprächen auf arte (2021). In der siebenten Folge mit dem Thema „Über religiöse Rede“ kommt er auf die Enzyklika „Laudato si‘“ zurück und beschreibt, worin er ihre Bedeutung sieht. Sie eröffne nämlich der Kirche eine „enorme Chance“. Worin…
-
Neue Beziehungen der Solidarität
Fünf Jahre nach ihrer Veröffentlichung kommt Frère Alois von Taizé auf die Enzyklika „Laudato si‘‘ zurück und betont ihre Aktualität und Dringlichkeit. Die durch die Pandemie ausgelöste Krise mache „auf einen Schlag deutlich, wie empfindlich der Planet Erde, unser gemeinsames Haus, ist“.
-
Laudato si‘: Eine kulturwissenschaftliche Lektüre
Aus der Enzyklika lässt sich in der Lektüre von Hartmut Böhme eine neue Funktion des christlichen Schöpfungsbegriffes entwickeln: „eine praktisch-ästhetische Einstellung zur Erde“ die auch „eine ethische Dimension“ beinhaltet: „Demut und compassio, Schonung und Pflege (das ist im Wortsinn cultura)“.
-
Der namensgebende Gesang
Der Sonnengesang Cantico di frate sole bildet den Referenztext und ist namensgebend für den enzyklischen Text des Bischofs von Rom, der in seinem Anregungs- und Auseinandersetzungspotenzial in den diesjährigen Einträgen in diesem Blog untersucht werden soll: Laudato si‘.
-
2025: Schrei der Erde – Schrei der Armen
Mit der Kombination des Schreis der Erde, die nicht schreit, und des Schreis der Armen, die man nicht hört, eröffnet die Schrift „Laudato si“ des Bischofs von Rom ein neues Paradigma und eine Chance für die Kirchen, sich auf den Gott der Inkarnation zu besinnen…
-
Eine Liturgie zur Umwandlung von Schmerz
Das Prinzip der Spiegelung der Artikel des Kleinen Katechismus Martin Luthers in seinen Katechismus- Liedern in umgekehrter Reihenfolge kommt hier an sein Ende. Als Beichtlied steht dem Text über die Zehn Gebote Luthers seine berühmte Nachdichtung und Vertonung des alttestamentlichen Psalms 130 „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ gegenüber. Damit tritt dieser Kommentarreihe noch…
-
Im Schatten
Die Spiegelung des Glaubensbekenntnis-Artikels aus dem Kleinen Katechismus und des Katechismus-Liedes Martin Luthers zum Abendmahl führt uns in einen Engpass. Der Glaube respektive das Abendmahl im Lied „Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt“ bleiben gefangen im Modus der Katechese, des Erklärens und richtigen Bedeutens.
-
Das G (g)emeinsame d(D)enken
Wenn sich das Vaterunser in Luthers Tauf-Lied „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“ spiegelt, stehen sich in der Form zwei Praktiken gegenüber: das Beten eines Gebetes und das Singen eines Liedes. Dies ist eine Konstellation, die sich als Öffnen des Denkens verstehen lässt.
-
Sagen, was man nicht weiß
In der Zufälligkeit der Spiegelung von Taufe und Vaterunser-Lied öffnet sich eine überraschende Perspektive. Sie besteht darin, dass sie die gewohnte und historische liturgische Kombination von Taufe und Credo – von „Du bist mein geliebtes Kind“ und seiner Antwort: „Ich glaube“ – was seinen Antwortteil betrifft, ändert in die Antwort: „Vaterunser“.
-
Logik und Praxis der Gnade
Im zweiten Gang finden sich das Glaubenslied und das Abendmahl einander gegenüber vor. Diese Spiegelung eröffnet überraschende Reflexionen. Zunächst gilt es festzustellen, dass Martin Luther das Glaubenslied „Wir glauben all an einen Gott“ direkt für den liturgischen Gebrauch geschrieben hat.
-
Spiegelungen: Katechismus // Katechismuslieder
In der zweiten Runde unserer Kommentare zu Martin Luthers Kleinem Katechismus knüpfen wir an eine anfängliche Beobachtung an. Martin Luther hatte durch die Tatsache, dass er den Teilen seines Kleinen Katechismus Lieder an die Seite stellte, Lehre mit Praxis verbunden. In der Reihenfolge nehmen wir Luthers Verweis auf die zehn Gebote im Letzten Teil des…
-
Beichte als Öffnung
Nach dem Umweg über das Abendmahl und damit über die Gemeinschaft, zurück auf die Beichte zu kommen, heißt zunächst, wieder den Einzelnen in den Blick zu nehmen: Das Ich. Dies ist von der Taufe her als ein angesprochenes und antwortendes zu verstehen. Die Beichte wird hier sehr persönlich und praktisch ein Prozess des Zuhörens und…
-
Abendmahl: Ein weiterer Umweg, diesmal durch den Wald
Auf die Taufe müsste konsequenterweise der Teil über die Beichte folgen, aber Luther geht wieder einen Umweg über das Abendmahl. In der antiphonischen Komposition des Kleinen Katechismus wird es nun explizit mehrstimmig, polyphon. Aus wechselnden Ich und Du wird über das Für-Dich nun ein Wir. Und dieses Wir ist körperlich gemeint: hoc est corpus meum.…
-
Taufe und pastorale Macht
Martin Luthers Umweg über das Vaterunser zur Taufe führt die antiphonische Komposition des Kleinen Katechismus, wenngleich sie bei ihm unausgesprochen bleibt, fort. Denn die Taufe als kirchliche Praxis ist zu aller erst ein Echo auf die Taufe Jesu. Er hat selbst nicht getauft. Aber zu seiner Taufe am Jordan kam zur johannäischen Taufe eine Stimme…
-
Umweg Vater Unser
Bevor Martin Luther in seinem Kleinen Katechismus vom Glaubensbekenntnis zur Taufe kommt, macht er einen Umweg. Dieser Umweg ist zugleich ein Interpretament, das auch als Technik des minderheitlich-Werdens gelesen werden kann. Auf unerwartet zärtliche Art und Weise wird hier das ‚Was‘ Luthers dem ‚Wer‘ eines Sprechers bzw. einer Sprecherin geöffnet.
-
Zwischen den Zehn Geboten und dem Glaubensbekenntnis
Zwischen den Zehn Geboten als dem ersten Teil des Kleinen Katechismus von Martin Luther und seinem zweiten Teil, dem Glauben, liegen nicht nur die Wechsel der An- und Aussprüche von „Ich bin“ über „Du sollst“ zu „Ich glaube“. Diese Wechsel setzen sich aber direkt in weiteren Wechseln fort, die ins Heute führen. Sie lassen sich…
-
Die Zehn Gebote
Blättert man in Martin Luthers Kleinem Katechismus, so fällt einem schnell sein strukturierendes Element auf: Die immer wiederkehrende Frage: Was ist das? Nach jedem Glaubenssatz stellt Luther diese Frage, um sie dann kurz und prägnant zu beantworten. Aber bevor es sich um etwas handelt, nach dem man überhaupt mit „Was?“ fragen kann, gehen Menschen durch…
-
Martin Luthers „Kleiner Katechismus“: Der Plan
Seit Januar 2017 schreibe ich hier einen Blog. Die veröffentlichten Texte folgen Arbeitsthemen des Zentrums, sind an konkreten Veranstaltungen und Projekten orientiert oder folgen begleitenden Lektüren. Im Jahr 2024 soll es um den „Kleinen Katechismus“ von Martin Luther gehen. Diese einst weit verbreitete Schrift soll darauf getestet werden, ob sie tatsächlich als „kleine“ bzw. minderheitliche…
-
2 Jahre Kirchenjahr: Der Bericht
Als ich im November 2021 begann, mich für meinen Blog näher mit den Festen des Kirchenjahres zu befassen, wollte ich versuchen, an die Schätze liturgischer, homiletischer und auch denkerischer Vollzüge heran zu kommen, die sich im Laufe der Zeit im Kirchenjahr abgelagert haben. Zugleich wollte ich versuchen, diese Schätze für heute zu lesen, sie mit…
-
Michaelis: Endspiel
Wie immer induziert man die gewaltigen Bilderwelten der biblischen Apokalypse bewerten mag, man kommt nicht umhin, in einschlägigen filmischen Großproduktionen ihre geldgierigen Nachfolger zu erkennen. Real und überaus beschämend ist ihr direkter Aufruf im Zusammenhang aktueller kriegerischer Handlungen. Doch es gibt eine andere Tradition von Endspielen…
-
Verklärung: Kleine Lichter
Das Fest der Verklärung Christi ist ein kleines Fest. Man könnte es minderheitlich nennen. Das kommt schon in den evangelischen Erzählungen von der Verklärung Christi darin zum Ausdruck, dass man ihrer ansichtig, nicht einmal Hütten bauen kann. Der verklärte Christus selbst schließt dies Ansinnen aus und verweist auf einen eher verschwiegenen Umgang mit dieser Erfahrung.
-
Mariae Heimsuchung: Gastfreundschaft
Dem alten Wort Heimsuchung haftet zumindest heute ein negativer, schicksalhafter Klang an. In der Bezeichnung des Festes der Maria meint es aber einfach Besuch. Dieser Besuch der Maria bei Elisabeth nach der lukanischen Überlieferung ist ein Fest der Bewegung, das die Gastfreundschaft als liturgische Grundform umreißt.
-
Johanni: Eine Skizze
Stöbert man in der Geschichte des Johannistages, dem 24. Juni als dem liturgischen Hochfest der Geburt Johannes des Täufers, so hat man den Eindruck auf einen Knoten von Überlieferungen gestoßen zu sein.
-
Ostern: Die Geschichte einer Frau
Auf den ersten Blick mag es überraschen, Ostern als die Geschichte einer Frau zu bezeichnen. Aber blickt man genauer hin, ist sie dies im doppelten Sinne, als die Geschichte, die eine Frau erlebt und als die Geschichte, die eine Frau erzählt. Als solche ist sie zudem „eine Geschichte erregter Körperbewegung“. Wir folgen dem 20. Kapitel…
-
Gründonnerstag: Verwandlungen
Von Alters her wird die Passion Christi „im wörtlichen Sinne begangen“. Pilger unterstreichen in ihren Berichten „ausdrücklich die körperlichen Anstrengungen, Mühen und Ermüdungen, die mit dieser Form des Begehens der Leidensgeschichte verbunden sind“. In diesem körperlichen Zusammenhang ist der Gründonnerstag durch die Christusworte: „Dies ist mein Leib.“ und „Dies ist mein Blut.“ bis heute als…
-
Palmsonntag: Draußen
Als das Christentum zum ersten Mal raus auf die Straßen einer Großstadt ging, reklamierte es sein Recht zu erscheinen, eine bisher vernachlässigte Art der Epiphanie. Das Besondere dieser Aktion, die man auch Demonstration oder Versammlung nennen könnte, besteht darin, dass ihre öffentlichen und damit politischen Bedeutungen „nicht nur durch den – geschriebenen oder gesprochenen –…
-
Mariae Verkündigung: Begegnung
Gibt es etwas Gemeinsames zwischen der Begegnung einer Frau mit einem Engel und der Begegnung einer Frau mit einem Bären? Für die Frauen hatte die Begegnung jeweils umstürzende Folgen, die jedoch unterschiedlicher kaum sein können. Einen Sinn macht die Eingangsfrage allerdings nur, wenn man die Begegnungen nicht vertikal hierarchisch, also in Seins-Kategorien von oben nach…
-
Epiphanias: Spurenlesen
Die Verwendung des Begriffes Spurenlesen eröffnet einen ungewohnten Hintergrund von Epiphanias, nämlich seine Naturgeschichte. Sie beginnt bei der Spurensuche und die hat „eine Vorgeschichte, die wir mit den Tieren teilen“. Sie ist ein Erbe aus der Zeit von „vor rund zwei Millionen Jahren, da wir uns von sammelnden Fruchtfressern zumindest teilweise in Spurensucher und jagende…
-
Weihnachten: Geburt
Es ist keine überraschende These zu behaupten, dass die Geburt zu „den häufigsten Motiven der europäischen Malerei“ zählt. Überraschender ist folgende Beobachtung: „Die Geburt, die [da] geschildert wird, ist kein gewöhnliches, sondern ein einmaliges, nicht darstellbares und widernatürliches Ereignis. Die christliche Theologie hat dazu beigetragen, die Geburt zu etwas Undenkbarem zu machen, indem sie sie…
-
Adventisch denken
Denkt man über das Offene und das stets zu Kommende nach, kommt man im deutschen Sprachraum an zwei Polen oder auch Überschreitungen nicht vorbei. Die eine findet sich markiert in der dritten Strophe der Elegie „Brod und Wein“ von Friedrich Hölderlin: „So komm! dass wir das Offene schauen, / […] / Dorther kommt und zurück…
-
Ewigkeit: Offene Zeit
In der Morgendämmerung des vergangenen Jahrhunderts fuhr ein feuerköpfiger junger Mann durch die Straßen von Paris. Meist trug er einen schwarzen Hut und hatte die Hosen in die Strümpfe gesteckt. Denn er fuhr nicht irgendwie: Er fuhr Fahrrad. Eines jener stilsicher einfachen Rennräder, die man auf alten Fotos sieht. Sie sind heute wieder angesagt. Der…
-
Vom Rande her
Vorabdruck aus dem Programm 2023 Als Martin Luther im Jahre 1523 in Wittenberg das Fronleichnamsfest abschaffte, tat er vor allem Zweierlei. Luthers theologische Argumentation angesichts dieser Tradition (ihrer Auswüchse sowieso), ist klar: Nach der Schrift ist das Abendmahl zum usus bestimmt, nicht zur visio. Sieht man jedoch die mit der visio verbundene Praxis genauer an,…
-
Was ist Liturgie?
Liturgie ist vor allem Tun insofern sich in ihm eine Öffnung oder Verbindung zu einer gemeinschaftlichen Öffentlichkeit herstellen lässt. Solches Tun beginnt mit dem Körper und schließt alles ein, was sich auf einer Bühne, in der Öffentlichkeit zeigen lässt. Dafür hat die griechische Tragödie Formen gefunden. Das Christentum hat diese Formen verschiedentlich geschrumpft, ritualisiert, in…
-
Dramaturgische Homiletik in fünf Szenen nach Motiven von Paulus, Pasolini, Taubes, Müller u.a.
I. PAULUS: Ich spreche zu Menschen, die mir unbekannt sind. Das Ende tritt nicht ein. Niemand erbarmt sich unser. Paulus weint ENGEL: Warum weinen Sie? Sind Sie barmherziger als Gott? PAULUS: Weshalb sind wir geboren worden? Eine Zeit vergeht ENGEL: Warum weinst du? Bist du barmherziger als Gott? PAULUS: Wäre es besser für uns, wenn…
-
Säkulare Liturgien
Sollten nicht nur Gedanken, sondern auch Praktiken aus ihren angestammten, mitunter verknöcherten Gehäusen ausgewandert sein? Bei genaueren Hinsehen ließ sich etwas derartiges auf der kürzlich vergangenen Fußballeuropameisterschaft der Frauen in London beobachten. Dabei stellt sich die Frage nach Praktiken, die dort vollzogen wurden und die man als säkular liturgisch bezeichnen kann. Sie hatten nicht nur…
-
leiturgia
„Die Tragödie kam mit dem Kult von Helden rund um frühe Heldengräber auf. Chöre fanden sich beisammen und ihren Ruhm zu tanzen, reiche Gönner, um die Chöre selber einzuüben und über Monate zu unterhalten. Ein Grabmal, ein Altar – ein Tanzplatz, eine Orchestra. Nichts anderes hieß für viele hundert Jahre leiturgia, ‚Werk für die Leute‘“.…
-
Der Mensch ist ein liturgisches Tier
Dieser markante Satz des eigenwilligen Sprachphilosophen Eugen Rosenstock-Huessy speichert nicht nur die Grundlagen liturgischen Denkens. Er lässt sich in unserem Zusammenhang von Trinitatis als Lebenszeit lebensliturgisch zuspitzen. Zumindest dann, wenn man sich der Frage stellt, dass „statistisch gesehen die häufigste Form einer Beziehung eines Menschen zu einem Tier darin besteht, es zu töten“. In unserer…
-
Trinitatis: Lebenszeit
Im Vorwort zu seinen „Meditationen über das Mysterium der Heiligen Dreifaltigkeit“ (1969) schreibt der französische Komponist und Organist Olivier Messiaen: „Die verschiedenen bekannten Sprachen sind vor allem ein Kommunikationsmittel. […] Die Musik aber drückt nichts direkt aus. Sie kann suggerieren, ein Gefühl, einen Seelenzustand auslösen, das Unterbewusste berühren, die Fähigkeiten zum Träumen vergrößern, und das…
-
Pfingsten: Neue Schöpfung
Im Nachvollziehen der Bewegungspuren in den einzelnen Stationen des Kirchenjahres haben wir bemerkt, dass zum linearen heilshistorischen Ablaufgedanken des Kirchenjahreskreises weitere Bewegungsräume hinzugetreten sind. Dabei kann offenbleiben, ob es sich um realräumliche Verschiebungen handelt oder um imaginär-räumliche bzw. innenräumliche, wie sie in der frühchristlichen Formel sursum corda verdichtet sind. Bis zur Himmelfahrt waren die Bewegungen…
-
Himmelfahrt: Bewegung am Rand
Ein anonymer kolorierter Holzschnitt der grafischen Sammlung Albertina in Wien aus der Mitte des 15. Jahrhunderts heißt „Christi Himmelfahrt“. Am oberen Bildrand sieht man zwei schwebende Füße. Sie tragen jeder ein Wundmal und sind von ihrer Mitte an von einem Gewand verdeckt, das in einer Ansammlung von Wolken verschwindet. „Vermutlich gibt es keinen Glauben ohne…
-
Ostern: Es ist Krieg in Sarmatien!
In Samartien ist Krieg! Wieder ist dieses von den alten Griechen und Römern so genannte Gebiet zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, östlich der Weichsel und westlich der Wolga heute ein Schlachtfeld Europas. Einer, dem das „Land Samartien“ besonders am Herzen lag, war der Dichter Johannes Bobrowski. Er selbst kommt aus dieser Gegend und hatte dort…
-
Karfreitag: Der Tod Gottes
Mein Gott! – In seinem Text dieses Titels kommt der französische Philosoph Jean-Luc Nancy auf den Tod Gottes zu sprechen. Während seiner Meditation einer Predigt von Meister Eckhart (Q52) nimmt er die alltägliche rhetorische Praxis des spontanen Ausrufes „Mein Gott!“ auf als „eine kulturelle Ablagerung, ein winziges Überbleibsel der Christenheit, das sich durch die Sprache…
-
Passion: Entzug
m Vergleich zur Sehnsucht der ersten großen Fastenzeit des Kirchenjahres, dem Advent, gestaltet sich die zweite, die Passion, wie ein Entzug. Als Mimese der Leidensgeschichte Jesu zeichnet sie den Menschen in dieser Perspektive: „Memento, homo“, bedenke, Mensch. Diese Formel geht zurück auf das „seit dem 7. J[ahr]h[undert] übliche Ritual der Büßeraustreibung“ und wurde seit dem…
-
Weihnachten, Epiphanias: Ein Geschenk
„Ich weiss nicht, wie alt ich war, vielleicht sieben, vielleicht zehn Jahre. Vor der Bescherung saß ich allein in einem dunklen Zimmer und dachte an das Gedicht ‚Alle Jahre wieder‘ oder sagte es. Was dabei eigentlich geschah, weiss ich nicht und der Versuch, es auszusprechen, würde nur eine Fälschung hervorbringen. Kurz, noch heute sehe ich…
-
Advent: Sehnsucht
„Sehnsucht kommt aus dem Chaos … ist die einz‘je Energie … eine Sucht“ heißt es im spektakulären Titel „Sehnsucht“ der Berliner experimental Band „Einstürzende Neubauten“. Es wurde auf ihrem Album „½ Mensch“ (1985) veröffentlicht und gleicht nicht nur einem Schrei. Dass eine derartige Sehnsucht etwas mit dem christlichen Advent zu tun bekommen könnte, erscheint zunächst…
-
Umbau
Lassen sich die Verpackungen von Christo und Jeanne Claude, hier der Triumphbogen in Paris (2021), oder der Reichstag in Berlin (1995), eigentlich als Strategien eines minderheitlich-Werdens lesen? Interessierten sei das im Juli erschienene Buch „minderheitlich werden. Experiment und Unterscheidung“ (Leipzig 2021) empfohlen. Am 23. August ist Jean-Luc Nancy in Straßburg gestorben …
-
Das Wort
Jütland, hoher Himmel, Dünen. Ein Mann steht dort im Dünengras. Er trägt einen Mantel über den Schultern und ruft in den Wind: Weh Euch, ihr Heuchler… Wenig später, beim unverhofften Antrittsbesuch des neuen Pastors auf dem Bauernhof Borgensgaard, erfahren wir: Es ist Jesus von Nazareth. Sein Vater und seine Brüder rufen Ihn Johannes. Sie sind…
-
Bildtheorien
In der Kinemathek in Lissabon hält der französische Bildtheoretiker Jean Louis Schefer im Jahre 1997 einen Vortrag mit dem Titel „Kinematographien“. Darin verfolgt er die Idee einer Genealogie der Bilder ausgehend von der Szene von Golgatha. Auf den ersten Blick erscheint diese Idee nur sinnvoll innerhalb einer christlichen Bildtheorie. Im größeren Zusammenhang einer Geschichte der…
-
Zur Rekonstruktion sakramentaler Formen
Im Laufe unserer Untersuchungen sind inzwischen eine Reihe von Bausteinen beschrieben, die in verschiedenen und auch erweiterbaren Kombinationen Möglichkeiten eröffnen, ein Mit-Sein herzustellen zwischen aufgezeichneten analogen Formen und einem anderen Analogen, was einer medialen Übertragung beiwohnt. Dieses muss als solches rekonstruiert werden, wenn eine Übertragung mehr soll, also bloßes Zuschauen und Zuhören zu erzeugen. Grundlage…
-
Showtime? Beobachtungen
Etwas Markantes passiert die Zwischenräume zwischen Menschen und ist zugleich kennzeichnend für gottesdienstliche Vollzüge: das Singen. Insbesondere das gemeinsame Singen birgt die spezielle Erfahrung, sich als Einzelwesen zu erleben, das in einen klingenden Gruppenzusammenhang gestellt sich wiederfindet, ohne sich darin aufzulösen. Gelegentlich deutet sich jedoch in den Zusammenhängen liturgisch-musikalischer Praxis in Gottesdiensten ein merkwürdiges Phänomen…
-
Bilder der Güte
Auf den Spuren von Arbeitsnomaden, die sich selbst nicht als homeless sondern als houseless bezeichnen, reiste die Filmregisseurin Chloé Zhao in die entlegensten Winkel der Vereinigten Staaten von Amerika. In ihrem Film Nomadland zeigt sie Bilder von Menschen unter denen sie, wo immer sie auch hinkam, Güte fand. Wie wäre es, wenn die Bilder, die…
-
In Bildern beten
In Andrej Tarkowskijs Film „Opfer“ von 1986 blättert der Protagonist Alexander, gespielt von Erland Josephson, in einem Bilderbuch und sagt: „Das ist wie ein Gebet.“ Angesichts der Bilder in diesem Buch – es sind Ikonen – verwundert diese Bemerkung nicht. Dennoch fügt Alexander unmittelbar hinzu: „Und dann ist all das verloren gegangen. Jetzt können wir…
-
Gesten erfinden
Wenn ein Bildschirmbild und die zu seiner Aufnahme hergestellte Realität ihre Verbindung verlieren, erstirbt die Realität. Das geschieht zum Beispiel, wenn, damit auf dem Bildschirm ein gewünschtes Bild entsteht, in der Realität eine völlig absurde Pose eingenommen werden muss. Dann wird die Realität durch eine simulierte Scheinrealität ersetzt. Wer bin ich also, wenn ich auf…
-
Grab und Bildschirm – ein Experiment
Einer Antwort auf die Frage danach, ob ein Bildschirm – österlich gedacht – schließlich ein leeres Grab ist, kann nur in Form eines Experimentes nachgegangen werden. Dies führt allerdings zu überraschenden praktischen Fragen. Zunächst folgen wir der Bildspur, die Georges Didi-Huberman in seinem Text über die Metapsychologie des Bildes legt und gehen von der dazugehörigen…
-
Wo bin ich, wenn ich vor einem Bildschirm bin?
„Wo bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin und nicht in meiner Phantasie“? In unserer heutigen, von elektronisch-digitalen Medien dominierten Welt bin ich dann wahrscheinlich vor einem Bildschirm. Aber wo bin ich, wenn ich vor einem Bildschirm bin? Was sich wie die simple Frage nach einer Ortsbeschreibung anhört, stellt sich als Frage nach…
-
bodyb(u)ilding
Was tun Frau oder Mann, wenn ihnen ihr Körper kurzzeitig abhandenkommt? Sie sehen in einen Spiegel. Sobald sie Mühe haben, sich im Spiegelbild selbst zu erkennen, korrigieren sie mit einer flinken unauffälligen Bewegung das Detail, das ihr Wiedererkennen fraglich erscheinen lässt und: Glück gehabt, der Körper ist wieder da. Was tun Frau oder Mann, wenn…
-
Worms liegt in Mexiko
Als Martin, der damals noch Luder hieß, 1483/84 im kursächsischen Mansfeld geboren wurde, unterbreitete Christoph Kolumbus dem portugiesischen König Johann II. seine Schifffahrtspläne. Sie führten wenig später zur Entdeckung Amerikas (1492). Diese Weltentdeckung ließ Martin Luther Zeit seines Lebens „seltsam unberührt“. Wenn Luther von den „Grenzen der Zivilisation“ sprach, meinte er Wittenberg. Als er sich…
-
Fernsehen als Fürsprache
Konsequent wie kaum ein anderer hat sich der französische Philosoph Gilles Deleuze dem Fernsehen verweigert: „Man wird zwangsläufig reingelegt, in Besitz genommen oder vielmehr dessen, was man hat, beraubt.“ Keine Interviews. Kein Porträt. Nach zwanzig Jahren beständigen Nachfragens antwortete Deleuze schließlich seinerseits mit einer Frage: „Und wenn wir es versuchten?“ Es entstand die Idee eines…
-
Televisualität
„Fernsehen ist eine überwiegend kommerziell geprägte massenkulturelle und daher notwendig triviale Form. Es ist einerseits primitiv und oft vulgär, andererseits auf eine komplexe, teure und aufwendige Technik gegründet“. Im Unterschied zu Medien wie der Schrift, dem Radio oder dem Film gibt es zum Fernsehen (und seinen medialen Hybriden) keine umfassende Theorie. Ein Grund für diesen…
-
the dark side
Weihnachten des Jahres 1883 verbrachte der Student Paul Nipkow allein in seiner Studentenbude in Berlin. Dort saß er vor „einem kleinen Tannenbaum, an dem die Kerzen brannten, einer billigen Petroleumlampe und einem Reichsposttelephon“, was ihm ein Freund geschenkt hatte. „Entweder beim Anblick der Christbaumkerzen, die ja flackern, oder beim Anblick des Telefons, das Alexander Graham…
-
Nachrichten
Auf der Weihnachtstafel des sogenannten Isenheimer Altares hat der Maler Matthias Grünewald vorn einen hellen und dahinter einen dunklen Engel gemalt. Beide spielen eine Art Gambe. Sieht man die beiden so an, fällt es einem nicht schwer, sich diese Musiker*innen (Männlich oder weiblich? Gute Frage!) im großen Orchester Paul Hindemiths vorzustellen. Cello spielend würden sie…
-
Als ob es keine Menschen mehr gäbe
Während der Vorbereitungen zu seinem Filmprojekt Il Vangelo secondo Matteo (1964) entschloss sich der italienische Filmregisseur Pier Paolo Pasolini, den Worten des Matthäusevangeliums streng zu folgen. Auf der Suche nach Drehorten kommt Pasolini schließlich davon ab, in Palästina zu drehen. Dort seien kaum Einstellungen möglich, ohne einen Telefonmast oder eine Autostraße im Bild zu haben.…
-
Wie ist es möglich, Sie hier zu sehen?
In einer traumartigen Filmszene irrt ein Mann durch die Straßen einer Stadt. Die Häuser sind verfallen, Zeitungen, Hausrat liegen herum. Er kommt an einem Schrank mit einer großen Spiegeltür vorbei, zögert, kehrt zum Schrank zurück, beginnt die Spiegeltür zu öffnen und sieht als sein Spiegelbild das Bild des anderen, dem er versprochen hatte, die Welt…
-
Fortsetzung folgt
Wie „auf Taubenfüßen“ kommen die wichtigsten Fragen ganz leise und oft ganz zum Schluss. So ist es für unseren Zusammenhang auch in der zweiten Folge der legendären Histoire(s) du cinéma, Geschichte(n) des Kinos, von Jean-Luc Godard. Die Folge ist überschrieben mit dem Titel Une histoire seul, Eine Geschichte allein. Man kann behaupten, dass in dieser…
-
Am Satellitenhimmel sein Fenster haben
Wenn ein Autor auch Filme macht und sogar Fernsehen, kann das missverstanden werden. Es kann aber auch zu Unterscheidungen führen, auf die es ankommt. Das ist der Fall bei Alexander Kluge. Er übt seine Tätigkeit in Film und Fernsehen dezidiert als Autor aus, und dies als literarischer Autor. Denn als Alexander Kluge zu Zeiten des…
-
Offene Bücher lesen
Die Entstehungsgeschichte von Hölderlins Roman „Hyperion“ gibt einen Blick auf die Einschätzung vermehrter Lesepraxis gegen Ende des 18ten Jahrhunderts frei, der uns Heutige erstaunt. Er lässt uns eher an Fragen des Umgangs mit Computerspielen und sozialen Medien denken. „Tatsächlich wurden gegen Ende des Jahrhunderts in bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen so viele Romane gelesen, dass Pädagogen,…
-
Tönendes Mondlicht
Bis heute am bekanntesten geblieben ist Franz Fühmann – vielleicht der bedeutendste Schriftsteller der DDR – durch seine Nacherzählungen für Kinder. Immer wieder sind sie mit verschiedenen Bildarbeiten aufgelegt worden. Ein groß angelegtes Projekt von Nacherzählungen alttestamentlicher Geschichten blieb ein lang gehegter Wunsch. Fühmann näherte sich den unterschiedlichen Quellen unter dem Aspekt der großen „Menschheitserzählungen“.…
-
Ein lebendiges Buch, vom Mond umgeblättert
Im Zusammenhang seiner Arbeiten zum mythischen Element in der Literatur und den damit verbundenen Nacherzählungen mythischer Stoffe, entwickelte Franz Fühmann den Plan, die Bibel für junge Leute zu adaptieren. Bereits 1972 erstellte er ein detailliertes Exposé, das sich in mehreren Überarbeitungsstufen in seinem Nachlass findet. Als er zehn Jahre nach dem Erstellen des Exposés für…
-
Der Mond ist aufgegangen
In einem Vortrag aus dem Jahre 1975 erläutert der Schriftsteller Franz Fühmann anhand von drei sehr unterschiedlichen Beispielen das, was er „Das mythische Element in der Literatur“ nennt. Eines seiner Beispieltexte ist das „Abendlied“ von Matthias Claudius, das allseits bekannt ist als „Der Mond ist aufgegangen“. Fühmanns Ausgangsfrage ist die Frage danach, woher die enorme…
-
Worte oder Wörter?
In seinem atemberaubenden Essay über den österreichischen Dichter Georg Trakl, „Vor Feuerschlünden“, hat der DDR-Schriftsteller Franz Fühmann seinen Leserinnen und Lesern „Erfahrungen mit Trakls Gedicht[en] mitzuteilen versucht“. Er hat dabei entdeckt: „dies Mitteilen war wiederum neue Erfahrung“ und zwar die eigene. Fühmann erkannte darin einen Widerspruch im Verstehen. Der besteht darin, dass „je mehr wir…
-
Umrisse
Die Frage danach, wie eine Gemeinschaft als neue Schöpfung (création commune) zu umreißen ist, erscheint konkret als ein Komplex von Fragen. Etwa der Frage danach, wie eine Gemeinschaft ohne Herrschaftsregime zu beschreiben ist. Was also eine Gemeinschaft anderes ist als etwas, was sich durch Abgrenzung definiert, als etwas, das durch Zusammenschluss stärker sein will als…
-
Wenn Endzeit plötzlich immer ist
Der erste Clemensbrief an die Korinther ist eines der ältesten kirchlichen Dokumente. Darin wendet sich die „in Rom weilende Kirche Gottes” an die „in Korinth weilende Kirche Gottes”. Um dieses am-Ort-Weilen auszudrücken, verwendet der Autor des Briefes nicht das griechische Wort, was einen ständigen, festen Wohnsitz bezeichnet, sondern im Gegenteil. Er schreibt paroikein, das Wort…
-
sub longum
Es gibt eine weit verbreitete liturgische und homiletische Praxis, die derart unscheinbar ist, dass sie nicht wahrgenommen, ja übersehen wird. Dabei könnte sie auch in nichtliturgischen Zusammenhängen eine kirchenweite, aktuell sogar gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben. Sie könnte nämlich den entscheidenden Unterschied markieren zwischen Selbstreferenz und einer denkerischen Praxis, zwischen Selbstbespiegelung und einer spirituellen Praxis, zwischen Selbstdarstellung…
-
Befreiungen
Am 19. Januar 1944 erhielt Freya von Moltke einen überraschenden Anruf von Peter Yorck von Wartenburg. Yorck teilte mit: „Helmuth ist verreist“. Freya Moltke verstand. Ihr Mann, Helmuth James von Moltke, war verhaftet worden. Er hatte einen Diplomaten per Telefon vor einer drohenden Verhaftung gewarnt. Nach einem kurzen Aufenthalt im Hauptquartier der Gestapo in der…
-
Der Tod, der Tod
Beim Hören der nachösterlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs fällt auf, wie schnell der Osterjubel, der aus der dramatischen, revolutionären Osterkantate „Christ lag in Todesbanden“ (BWV 4) aufsteigt, getrübt wird durch Worte und Töne der Verzagtheit und Trauer, ja der Todesfurcht. Die Kantaten zum Sonntag Jubilate (BWV 12, 103, 146) etwa „befassen sich mit dem Schmerz…
-
Auszug
aus: Dietrich Sagert, Lautlesen. Eine unterschätzte Praxis, Leipzig 2020: Die hebräischen Texte, die wir Altes Testament zu nennen die Gewohnheit haben, hatten bis ins siebte Jahrhundert hinein die Besonderheit, nur als Konsonanten aufgeschrieben zu sein. So konnten nur diejenigen diese Texte lesen, die die zu den Konsonanten gehörenden und somit bedeutungsstiftenden Vokale kannten. Der Erforscher…
-
Zu Gast
Der auferstandene Christus kommt, um im Innersten des Menschen ein Fest zu feiern. Er bereitet einen Frühling der Kirche: eine Kirche, die über keine Machtmittel verfügt und bereit ist, mit allen zu teilen, ein Ort sichtbarer Gemeinschaft für die ganze Menschheit. Er wird uns genügend Phantasie und Mut geben, um einen Weg der Versöhnung zu…
-
Noli
Im Konzert der Praktiken des Auferstandenen Christus, wie sie das Neue Testament überliefert, findet sich eine Geste, die bis zur Unkenntlichkeit überdeckt wird von einer staatlichen Hygiene-Vorschrift unserer Tage. Sie kulminiert im Satz des Johannesevangeliums: „Rühre mich nicht an“, wie Martin Luther übersetzt (Joh 20, 17). In seinem kleinen Buch „Noli me tangere“ ist der…
-
Passio
Der estnische Komponist Arvo Pärt hatte nach einem mehrjährigen Schweigen als Komponist seinen Stil der tintinnabuli (Glöckchen) erfunden. Als eines der Hauptwerke dieses Stiles gilt die Johannespassion. Sie wird im Allgemeinen nach dem ersten Wort ihres Textes schlicht „Passio“ genannt. Musikalisch orientiert sich Pärt an frühen Passionen, wie sie sich von intonierten liturgischen Lesungen ausgehend…
-
Was du hast ist, Atem zu holen
Im Jahre 1977 wurde das Berliner Olympiastadion, zum Schauplatz eines legendären Ereignisses: Unter dem Titel „Winterreise. Textfragmente aus Hölderlins Roman ‚Hyperion oder der Eremit in Griechenland‘“ besetzten es der Theaterregisseur Klaus-Michael Grüber und sein Ensemble der Berliner Schaubühne auf eine besondere Art und Weise und legten es in die Hände (oder besser: unter die Füße)…
-
memorandum
Eines Nachts Ende April oder Anfang Mai des Jahres 1720 hatte der sardische Vizekönig Saint Rémys, dessen Verantwortlichkeiten vom König sehr reduziert gehalten waren, einen bedrückenden Traum. Einen Monat vor dieser Nacht war in Beirut ein Schiff mit Namen Grand-Saint-Antoine in See gestochen. Dieses Schiff befindet sich nun gerade vor Cagliari und bittet um Einfahrt…
-
Sie denken uns
Seit den Anfängen Europas erzählt man sich die Geschichte von einer Gruppe von Frauen aus dem mittleren Osten. Sie tauchen an der Grenze von Argos in Griechenland auf und bitten um Schutz. Man heißt sie willkommen nach dem Gesetz der Gastfreundschaft. Doch schon bald entspinnt sich ein Konflikt um den Empfang der Fremden. Die Rede…
-
Hände
Der Film „Bildbuch“ des schweizer-französischen Filmregisseurs Jean-Luc Godard aus dem vergangenen Jahr hat eine gerade für seine deutschen Zuschauer auffällige Besonderheit. Godard spricht selbst Texte, was er seit Jahren tut, aber hier spricht er sie zum ersten Mal selbst auf Deutsch! Und so beginnt der Film, wie auch der Trailer, (dem noch vorgeschaltet ist, dass…
-
Körperwerden
There ist nothing in heaven as the suffering of the humans lives (Patti Smith) Glaubt man dem Bildgedächtnis der Christenheit, ist Körperwerden die Hölle. Ihre grundlegende Praxis besteht in einer verworrenen Kombination von Lust und Strafe. Sie verherrlicht dabei eine einzige körperliche Praxis, die Qual. Wie sehr und auf welche Weisen dies geschieht und kulturprägend…
-
…ho logos…
Es ist nicht ungewöhnlich, das Johannesevangelium der literarischen Gattung des antiken Dramas anzunähern. Damit hätte der Beginn des Evangeliums die Form eines dramatischen Prologs. Ein Prolog gebe „einen Hinweis auf den folgenden logos“, schreibt Aristoteles in seiner Rhetorik. Ein Prolog zeige an, worum es im Folgenden gehe. Das sei so in Prosagedichten, wie zum Beispiel…
-
Ein Theater der Stimme – Exsultet
Die legendäre Inszenierung der euripideischen Bakchen von Klaus Michael Grüber 1974 an der Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer ist mancher/m als die wichtigste ihre/seines Lebens in Erinnerung geblieben. Für den Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann lässt Klaus Michael Grüber damit das „neuzeitliche Drama“ als eine „Welt der Diskussion“ hinter sich und schlägt den „Bogen zurück zu jener…
-
Auf einer schwankenden Spitze kreisend
Die Erkenntnis Bruno Latours, dass die religiöse Rede, also die Predigt, eine invention fidèle, eine wahrheitsgetreue Erfindung ist, hat eine ausgesprochen theatrale Seite. Sie führt in der Praxis von der stillen Lektüre über das laute Lesen in die Erfindung szenischen Spiels. Dieser schöpferische Prozess lässt sich erzählpraktisch bis in die Evangelien zurückverfolgen. Wie Bruno Latour…
-
théâtre pauvre: Krippenspiel II
„Für ein armes Theater“ heißt ein Artikel des polnischen Theaterregisseurs und –Theoretikers Jerzy Grotowski aus dem Jahre 1967. In diesem Artikel geht es nicht um Krippenspiele. Aber er kann in mancherlei Hinsicht wie eine Anleitung für Krippenspiele gelesen werden. Armes Theater, théâtre pauvre, bedeutet für Grotowski, schrittweise zu eliminieren, „was sich als überflüssig erwies, wir…
-
théâtre pauvre: Krippenspiel
Die berühmte Szene an der Krippe von Greccio gilt als das erste Krippenspiel in der Geschichte der Christenheit und Franz von Assisi als der Erfinder dieses Theaters. Was für die griechische Tragödie nach Aristoteles als mimesis beschrieben wurde, verwandelte Franziskus in eine imitatio der biblischen Geschichte. Ein in mehrfacher Hinsicht überraschendes Experiment unternahm der Dramaturg und…
-
minderheitlich werden IV
Wie kommt einer der bedeutendsten Anthropologen dazu, von seiner Wissenschaft „als mindere Wissenschaft“ zu sprechen? Die Spur der Antwort auf diese Frage findet sich im Haupttitel des Veröffentlichungsprojektes, deren Untertitel die „Anthropologie als mindere Wissenschaft“. Der Haupttitel heißt:„Anti-Narziss“ und die Antwort wie folgt: „Das Hauptanliegen des „Anti aber entlehnen wir meiner Disziplin doch hier einmal…
-
Körper
Ausgehend von den Schilderungen des Körpers des Auferstandenen in den Evangelien stellt sich immer wieder die Frage danach, wie der auferstandene, verherrlichte Körper vorzustellen sei und was sich daraus für eine körperliche Praxis der Auferstehung folgern lässt. Dabei müsste es um die Frage gehen, „ob man eine Physiologie des verherrlichten Körpers formulieren kann“. Das hieße…
-
Ein Gastspiel
Hauptsatz der homiletisch-liturgischen Theorie und Praxis.
-
Paris. Ostern 1294
Der junge Dominikanermönch Eckhart ist Magister an der Universität in Paris. Zu Beginn des Semesters 1293/94 hatte er einen Vortrag zur Einleitung seines Kommentars über die berühmten Sentenzen des Petrus Lombardus gehalten und sich darin nicht lange bei den üblichen Schulweisheiten aufgehalten, sondern direkt zu Beginn Bibelauslegung mit Naturforschung kombiniert. Ostern beginnt Eckhart seine Predigt…
-
„So wie es bleibt, ist es nicht“ (III)
Der Dada-Erfinder, Hugo Ball, hatte Anfang der 1920er Jahre in seiner Schrift „Die Folgen der Reformation“ überdeutlich die aus der Reformation hervorgegangene deutsche Verbindung von Thron und Altar für das Grauen des Ersten Weltkrieges verantwortlich gemacht. Um die Radikalität seiner Analyse ins rechte Verhältnis zu setzen, zeichnete er drei Heiligenleben des „Byzantinische[n] Christentum[s]“. Balls Blickrichtung…
-
Lautlesen
Bei seinen Untersuchungen der Quellentexte des alten Griechenland beobachtete Friedrich Nietzsche, dass Literatur zunächst gar nichts mit „litterae oder Lettern“ zu tun hatte. Zumindest bis Euripides, von dem überliefert ist, dass er zu den wenigen Athenern zählte, die eine Bibliothek besaßen, waren nämlich griechische Denker keine Schreiber. Denn ihre Verse fanden als „rhapsodischer Vortrag, lyrischer…
-
Jesus died for somebody’s sins
Lange bevor Patti Smith bekannt und mit dem popkulturellen Prophetinnen-Titel Godmother of punk geehrt wurde, begann sie als Dichterin auf den Spuren des von ihr bis heute verehrten Arthur Rimbaud. Das Singen war für sie zunächst vor allem eine Möglichkeit, ihre Gedichte vorzutragen. 1970 schrieb Patty Smith ein Gedicht mit dem Titel Oath und las…
-
Römerbrief
Unter der Überschrift „Vatertränen, nur zu denkende“ beginnt der Philosoph Hans Blumenberg einen Gedankengang mit folgender Feststellung: Im Unterschied zu den natürlicherweise mit dem Tod des Vaters endenden Vater-Sohn-Konflikten, endet der „im Garten Gethsemane ausgetragene“ Vater-Sohn-Konflikt mit dem Tod des Sohnes. Der Schrei Jesu am Kreuz Eli, Eli… sei „der denkbar größte aller Vorwürfe gegen…
-
…und sie gingen auf einem anderen Weg
Im Laufe der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitete der kanadische Philosoph Constantin Boundas aus Ontario an seiner Doktorarbeit über Paul Ricœur. Bei einem Aufenthalt in Paris fielen ihm in einer Buchhandlung Schriften von Gilles Deleuze in die Hände. Er wechselte das Thema seiner Doktorarbeit. Während eines erneuten Aufenthaltes in Paris im Jahre 1989 trifft…
-
Zur Kritik konsumistischer Rede und ihrer ästhetischen Formen
In der pointierten Beobachtung des schweizer-französischen Filmregisseurs Jean-Luc Godard haben die Deutschen wegen der Schrecken, die sie eigenhändig während des Zweiten Weltkrieges verbreitet hatten, „selbst die Idee, Deutsch zu sein, verloren bzw. diskreditiert“. Deshalb „hat ein Teil gewählt, amerikanisch zu werden, und der andere Teil, sich nicht zu bewegen.“ Bis heute hat dieses Statement Godards…
-
minderheitlich werden II
Durch die evangelischen Kirchen unseres Landes geht ein Riss. Es fällt zunehmend schwer, die Erfahrungen der Christinnen und Christen in der ehemaligen DDR verständlich zu machen. Die Denkfigur des „Minderheitlich-Werdens“ eröffnet ein Feld der Wahrnehmung jenseits der eingeübten Frustrationen, die oftmals von mehrheitlichen Gesten herrühren. Minderheitlich-Werden bedeutet nämlich nicht, mehrheitlich werden zu wollen, sondern im…
-
Martyr/olog
Seinen Tagebüchern stellt der russische Filmregisseur Andrej Tarkowskij eine Reihe idyllisch anmutender Schwarz-Weiß Fotographien aus seiner Kindheit voran. Viele von ihnen glaubt man als Filmbilder nachgestellt aus seinem Film „Der Spiegel“ zu kennen. Und man versteht, dass die Schönheit der erinnerten Bilder nicht deckungsgleich sein muss mit dem in ihnen erfahrenen Leben, deren Abbilder sie…
-
Gastfreundschaft
Zu einer Zeit, als die Sehnsucht nach Freiheit in (Ost-) Europa und der Welt noch Phantasie und Widerstandskraft bei den Menschen freisetzte, gab es in Prag eine Untergrund-Universität. Gelehrte aus aller Welt ließen es sich nicht nehmen, auf verbotenen Zusammenkünften in Wohnungen Vorlesungen zu halten. Sie vertrauten auf die Kraft des Denkens, die herrschende Dummheit…
-
HELL Canto 14
Bei ihrer Wanderung durch den dritten Ring des siebten Höllenkreises gelangen Dante und Vergil an die Ufer des blutroten Stromes Phlegethon. „Schweigend kamen wir dorthin, wo aus dem Wald ein kleiner Fluss kräftig heraus strömt, dessen blutrote Farbe mich jetzt noch erschaudern macht. […Er] ergoss sich abwärts durch den Sand. Sein Boden und die beiden…
-
Extra: Szenen zum 20. Juli 1944
Stauffenberg: 7.00 Uhr Abfahrt zum Flugplatz Rangsdorff, Haeften ist schon dort. Kuriermaschine Richtung Rastenburg, Ankunft gegen 10.15 Uhr. 11.30 Vorbesprechungen. Haeften wartet, mit zwei mal 975 Gramm Plastiksprengstoff deutscher Herstellung mit je zwei englischen Übertragungsladungen. In einer Packung enthält die Übertragungsladung einen englischen Zünder für nominell 30 Minuten Zündverzögerung. In der anderen Ladung befindet sich…
-
Was die Sprache nicht schafft, das schafft der Ton
Quid me mihi detrahis? Warum entziehst Du mir (mir) selber mich? fragt Marsays den Apoll während ihm von dessen Schergen die Haut abgezogen wird. So überliefert es Ovid. Diese Frage klingt wie das Echo auf einen anderen „Zweikampf“: Quere dereliquisti me? Warum hast du mich (dir) entbunden? So könnte man die Frage des im Matthäusevangelium…
-
Unterwanderungen
Die Bachkantate für den Ostermontag (BWV 6) kreist um die Bitte „Bleib bei uns“, wie sie die Emmausgeschichte im Lukasevangelium (24, 13-15) berichtet. Diese Bitte der vom Tode Jesu traumatisierten Jünger an den unerkannten Spaziergänger – mit Heiner Müller müsste man daran erinnern, dass der Aufstand als Spaziergang beginnt – ist eine der charakteristischen österlichen…
-
Der helle, helle Tag
Im Februar des Jahres 1968 traf sich der russische Filmregisseur Andrej Tarkowskij mit seinem Szenaristen in der Nähe von Moskau. Beide wollten die literarische Version eines Filmprojektes erarbeiten, worüber Tarkowskij schon seit längerer Zeit unter dem Titel „Der helle, helle Tag“ nachdachte. 1974 erschien der Film unter dem Titel „Der Spiegel“ (Serkalo) in den Kinos.…
-
Liturgie und Drama
Wenn während der sogenannten Lutherdekade und somit auch während des letzten Jahres 2017 ein genuin lutherisches Thema gänzlich ausfiel, dann war es Luthers endzeitlicher Furor. Das beängstigende finale Grollen am Himmel ist verstummt. Und niemand hätte das angemessener zum Ausdruck bringen können als der berühmteste Student der Universität Wittenberg – nämlich: Hamlet. Und zwar mit…
-
Endzeiten
Death Valley, Kalifornien. Im Mai 1975 unternahmen der französische Philosoph Michel Foucault und zwei seiner Freunde einen Ausflug. Während eines zweitägigen Aufenthaltes am Zabriskie Point und in Höhlen, die an den Roden Crater erinnern, setzten sie sich einem Experiment aus. In dieser überwältigenden Wüstenlandschaft nahmen sie eine genau bemessene Dosis von klinischem LSD zu sich, hörten…
-
In manos tuas
Wofür interessiert sich jemand, wenn sie/er sich für eine produktive experimentelle Praxis, in der „sich das Manuelle nicht von den Ideen trennen lässt“, interessiert? Sie/er interessiert sich für Hände, Hände als „Bewusstsein einer Handlung“. Albert Flocon war 1933 aus Deutschland nach Paris emigriert und hatte sich nach 1945 auf die Kupferstecherei konzentriert. Ende der vierziger…
-
Rätsel mit und ohne L
Auf einer elliptischen Bühne sitzt ein Junge. Auf dem Boden der Bühne leuchten Kreise, Ellipsen, Linien. Kosmische Umlaufbahnen, Zeichnungen geometrischer Berechnungen? Zuschauer sitzen in einer Arena um die Bühne herum. Am oberen Rand stehen schwarz gekleidete Sängerinnen und Sänger, die Gewänder rauschend eingezogen waren… Der Junge verharrt an seinem Platz. Trotz der Dunkelheit herrscht eine…
-
Wer da?
Der berühmteste Student der lutherischen Universität Wittenberg ist Hamlet. Glaubt man William Shakespeare, so hat Hamlet an Martin Luthers Universität in Wittenberg studiert. Als Luthers Schüler wird Hamlet im Allgemeinen nicht verstanden, obwohl einige seiner bekannten Sätze sich passgenau auf lutherische Positionen beziehen lassen. So die einfache Frage „Wer da?“, mit der sein Stück beginnt.…
-
El africano
Der spanische Dramatiker und Dichter Félix Lope de Vega Carpio (1562-1635) veröffentlichte im Jahre 1623 eine tragicomédia famosa mit dem Titel El divino africano. Im Zentrum dieses Theaterstückes steht der Afrikaner Augustinus, der Bischof von Hippo. Zuzüglich zu den Confessiones, die die inhaltliche Grundlage des Stückes bilden, erfindet Lope de Vega ein Martyrium des Augustinus…
-
Große(s) Leuchten und kleine Lichter
In dem kleinen toskanischen Städtchen Bagno Vignoni befindet sich, wie der Name schon sagt, ein altes Bad, ein Thermalbad. Es ist der Heiligen Katharina von Siena gewidmet und steht im Zentrum des Filmes „Nostalghia“ von Andrej Tarkowskij. In Tarkowskijs Film wohnen in einem an das Bad angrenzenden Hotel die Kurgäste. Unter ihnen ein russischer Dichter.…
-
OST
In einem Interview aus dem Jahre 1990, in dem es auf die Rolle der Kirchen in der ehemaligen DDR kam, sagte Heiner Müller: „Aber die Kirche konnte einfach Phantasieräume besetzen, die durch eine dilettantische Praxis vakant geworden waren“. Dieser Satz entfaltet seine aktuelle Brisanz vor dem Hintergrund eines anderen Gedankens von Heiner Müller, der das…
-
Wie tief uns der Schrecken traf
Der harsche Kritiker des Ersten Weltkrieges und Martin Luthers, was bei ihm beinahe auf eines hinauslief (!), Hugo Ball, war kein ausgiebiger Leser der Schriften Augustins. Auf der Suche nach der Sprache Gottes, die im Kriegsgeschrei von den Kanzeln der Kirchen Europas verschwunden war, hatte er seine Sprachexperimente auf der Dada-Bühne des Züricher Cabaret Voltaire…
-
Extra: Zwei Zentren (F) – eine Ellipse
(F1) – Homiletischer Imperativ Als der junge Helmuth James von Moltke im Jahre 1927 die Lebensbedingungen im nur dreißig Kilometer von Kreisau entfernten niederschlesischen Bergbaugebiet zahlenmäßig zu untersuchen half – zu der Zeit lebten in dieser Gegend doppelt so viele Menschen pro Quadratkilometer wie im Ruhrgebiet „auf einem vom Bergbau unterhöhlten, absackenden, nassen Grund, so…
-
luther minor
Martin Luther hat den deutschen Sprachimpuls entschlossen wieder aufgegriffen. – Erich Auerbach sah in der Praxis des sermo humilis ein pfingstliches Wirken – Und ganz in diesem pfingstlichen Sinne hat Luther dem deutschen sermo humilis mit seiner Bibelübersetzung zu einem überwältigenden Durchbruch verholfen. Luthers Bezugnahme auf Augustinus von Hippo kann auch dabei kaum überschätzt werden. Seine…
-
ledic stâ
Die Erfindung eines sermo humils in deutscher Sprache war für den Dominikanermönch, den man Meister Eckhart zu nennen gewohnt ist, im Vergleich zu Dante anders motiviert. Eckhart’s bevorzugte deutsche Ausdrucksform war die Predigt. Und so überraschend es auch erscheinen mag, für Meister Eckhart war eine Predigt so etwas wie eine Denkwerkstatt. Seine deutschen Predigten stehen…
-
Los jetzt!
Dante hatte sich entschlossen, seine Commedia divina im volgare zu verfassen. Er erfand ein sermo humilis, der verschiedene Sprachebenen nebeneinander stehen ließ. Für aufmerksame Klassiker unter seinen Lesern, bot dies durchaus Anlass zu Kritik. In seiner neuen Sprache begann Dante nicht nur seinen literarischen Ausdruck zu verändern, er las die Wirklichkeit neu: Als Dante das…
-
sermo humilis
Der deutsche Literaturwissenschaftler und Romanist Erich Auerbach verfasste in seinem amerikanischen Exil, in dem er bis zu seinem Tod 1957 lebte, eine Studie zum sermo humilis. Darin beginnt Auerbach mit der Lektüre einer Predigt von Augustinus und stellt fest, dass „diese rhetorische Art des Ausdrucks im ganzen und alle ihre Formen […] der antiken Schultradition“…
-
minderheitlich werden
Das Gedenken und Jubilieren der 500 Jahre Reformation wird unterwandert von der Jahreszahl 1917. Wobei ‚Luther 1917‘ im Rausch des Ersten Weltkrieges davon nichts mit bekam. Die vergessene Vorgeschichte der eigentlichen Unterwanderung von 1917 findet sich in einem Tagebucheintrag des Dadaisten, Reformations- (und Erste-Weltkriegs-) Kritikers und Homiletikers Hugo Ball. Er notierte am 7. Juli 1917…
-
Anderswo
Ein Leser mit notorischen Unterwanderungstendenzen ist der französische Philosoph Jacques Derrida. Unter den Referenzen seiner Lektüremethode, der Dekonstruktion, findet sich der Begriff der destructio von Martin Luther. Die besondere Perspektive aber, die sich an dieser Stelle öffnet, besteht in der Tatsache, dass Jacques Derrida ein ausgiebiger Leser des Augustinus war.
-
Licht und Schatten
Martin Luther war fast zwanzig Jahre seines Lebens Augustiner(-Eremit). Die prägende Kraft einer solchen Lebensform hat sich unter die Adiaphora des Gedenkens und Jubilierens der 500 Jahre Reformation verkrümelt. Dabei könnte sie als Schlüssel zu Luthers Glauben, Denken und Reformieren gelesen werden. Auf den Namenspatron dieses Ordens bezogen kommt man an einer Schlüsselstellung kaum vorbei.…