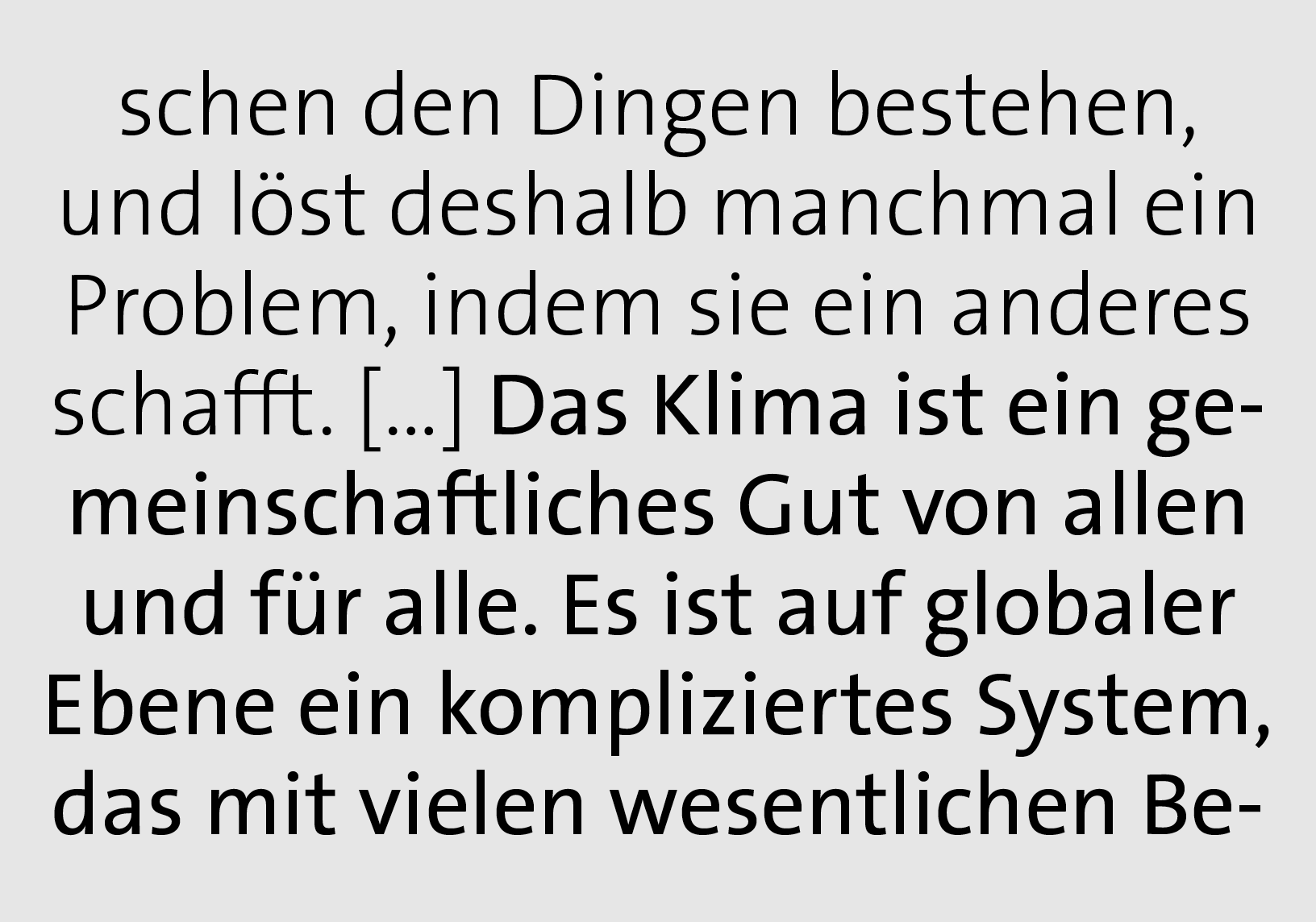Die Art und Weise wie wir im modernen Westen die Dinge sehen hat sich im frühen Griechenland entwickelt, als die Menschen feststellten, dass nicht alles, was sie umgibt, von den Launen der Götter abhängt und durch sie entsteht. Vieles ließ sich aus sich selbst heraus, also aus der Erkenntnis der physischen Eigenschaften der beteiligten Phänomene erklären und wurde also von der Natur hervorgerufen. Diese Erkenntnisse der griechischen Philosophie und Wissenschaft wurden durch das Christentum verstärkt, insbesondere durch die Vorstellung der „Trennung von Schöpfer und Geschöpf“ und durch die Vorstellung, „dass diese gesamte Welt das Produkt der Handlung einer Gottheit ist, durch die es auch Transzendenz gibt. Es gibt eine Trennung, eine Überlegenheit und Äußerlichkeit des Schöpfers in Bezug auf das Geschöpf, wobei die Menschen eine Sonderrolle einnehmen. Denn die Menschen haben den Auftrag erhalten, über diese Schöpfung zu wachen.“ [1]
Im 17. Jahrhundert prägte sich diese Vorstellungen weiter aus und führten schließlich zu dem, was Philippe Descola den Naturalismus nennt.[2] Dies geschah mit der der sogenannten „Mechanistischen Revolution“ und Autoren wie Galilei, Descartes oder Bacon. „Für sie war die Welt mathematisch erfassbar und auf wissenschaftliche Gesetze reduzierbar. Diese wissenschaftliche Revolution im 17. Jahrhundert ging aus einer neuen Vorstellung der Natur hervor. Maurice Merleau-Ponty sagte in seinen Vorlesungen am Collège de France[3], dass nicht die Anhäufungen wissenschaftlicher Erkenntnisse die Vorstellung von Natur verändert habe, sondern dass die veränderte Vorstellung von Natur die Entwicklung der Wissenschaft überhaupt erst ermöglichte. Ich behaupte sogar, dass nicht eine veränderte Vorstellung von Natur, sondern die Entstehung ihres Konzeptes der ontologische Nährboden war, auf dem sich die Wissenschaften ab dem 17. Jahrhundert entwickeln konnten. Eins wäre noch hinzuzufügen: Die Bilder waren zuerst da, noch vor der diskursiven Ausformulierung dieser neuen ontologischen Ordnung im 17. Jahrhundert, die ich Naturalismus nenne. Denn ab dem 15. Jahrhundert tauchen in der Malerei die zwei Hauptelemente des Naturalismus auf. Erstens die Singularität des Menschen im Vergleich zu allen anderen Wesen, seine kognitive und moralische Sonderstellung. Sie kommt in der Porträtmalerei zum Ausdruck, einer einzigartigen Kunstform, die es zuvor praktisch nicht gegeben hatte. Und zweitens die Tatsache, dass die Menschen sich in einem homogenen Raum bewegen, was Descartes als res extensa bezeichnete[4]. Das zeigt sich auch in der Entwicklung der Landschaftsmalerei mit der Erfindung der Perspektive. Die Welt wird durch ein menschliches Subjekt objektiviert, dass ich einen Beobachtungspunkt sucht und seinen Blickwinkel wählt mit Hilfe geometrischer Prozesse, die von den großen norditalienischen Meistern und Theoretikern des 15. Jahrhunderts erfunden wurden.“[5]
Seine endgültige Form nahm der Naturalismus allerdings erst im 19. Jahrhundert mit der Entstehung der Vorstellung von Kultur an. Sie entsteht in der „Annahme, dass es kollektive Subjekte gibt, dass Menschen in Gesellschaften leben. Auch das ist ein relativ junges Konzept. Und dass diese Menschen die Fähigkeit haben, eine gemeinsame Sichtweise auf die Welt zu entwickeln, die sie umgibt.“[6] In Unterscheidung und Überlappung mit Begriffen wie Gesellschaft, Zivilisation u.a. kristallisierte sich die Auffassung von Kultur „als einer Realität sui generis, die sich von einer Natur unterscheidet“[7] heraus. Damit ist das hergestellt, was Descola „die große Trennung“[8] nennt. Sie sitzt im Zentrum des Naturalismus und wird in der Herausarbeitung der vier Ontologien zu relativieren versucht und im Zusammenhang der aktuellen Klimakrise in neue Perspektiven gestellt.[9]
Auf die Frage, was wir waren, bevor wir Naturalisten wurden, antwortet Philippe Descola: „Wir waren bis zur Renaissance das, was ich als Analogisten bezeichne. Analogismus ist eine bestimmte Art, Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen zu betrachten. Er beruht auf der Annahme, dass die Welt aus Besonderheiten, Einzelheiten, Elementen, Zuständen und Situationen besteht, die man ordnen können muss. Wie ordnet man sie? Durch Entsprechungen, indem man die Dinge in ein Verhältnis zueinander bringt. Also durch Klassifizierungen wie Tag verhält sich zu Nacht wie Schwarz zu Rot, wie Adler zu Dachs, wie Frau zu Mann usw. Diese Entsprechungen (analogies) beruhen auf einer analogistischen Logik, die in diesem Ontologien besonders ausgeprägt ist. Es ist eine Art, die Realität wahrzunehmen, die in der mediterranen Antike, im Mittelalter und bis in die Renaissance sehr verbreitet war und bis heute in anderen Regionen der Welt existiert. Ich denke dabei natürlich an den Fernen Osten, an Indien, wo der Glaube vorherrscht, dass nichts aus diesem Geflecht von Entsprechungen ausgeschlossen werden darf. Hinweise auf die analogistische Ontologie findet man auch in der Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos. Damit ist die Vorstellung gemeint, dass die Welt ein Körper in Miniaturform ist und es Analogien zwischen den Elementen des Körpers und denen der Welt gibt. Wo etwas findet man in analogistischen Zivilisationen ständig. Wir haben das im Naturalismus in Form von Horoskopen beibehalten, die es im Animismus oder bei den australischen Aborigines zum Beispiel nicht gibt – ein Symptom des Analogismus […] Der Naturalismus hat die Besonderheit, dass er an einem einzigen Ort entstanden ist im Gegensatz zu den anderen Ontologien, die überall auf der Welt Archipele gebildet haben. Mir scheint, der Naturalismus kann nur auf analogistischem Boden gedeihen. Gerade in der Astrologie und in der Medizin gehen die Analogisten davon aus, dass die Welt aus einer begrenzten Anzahl einzelner Elemente besteht und dass jedes dieser Elemente Eigenschaften hat, die überall gelten. Ich denke, es braucht eine analogistische Welt, damit der Naturalismus entstehen kann. Und doch ist es nur einmal passiert, weil die Umstände anderswo nicht gegeben waren. Ich denke insbesondere an den Fernen Osten und China, an das antike Griechenland, die islamische Welt im Mittelalter. Auch hier gab es die entsprechenden Voraussetzungen, aber aus einer ganzen Reihe von Gründen, die politischer Natur waren oder mit der Beziehung zwischen den Gelehrten und ihrem Umfeld zu tun hatten, konnten sich die naturalistischen Überzeugungen nicht verfestigen. Das gehört in den Bereich der Wissenschaftsgeschichte…“[10]
„Der Naturalismus ist ein Nährboden, auf dem bestimmte Wissenschaften mit ihren Merkmalen gedeihen konnten. Aber es gibt wilde Wissenschaften, wenn man das so Sagen kann, die auf empirischem beruhen, die man nur sehr schwer von der ontologischen Umgebung trennen kann, in denen sie sich entwickelt haben. Das ist eine zeitgenössische Tendenz, man sagt, und das ist absolut nicht falsch, dass die Amazonasvölker erstklassige Botaniker und Pharmakologen sind, wie sie biologische Eigenschaften isoliert haben. Wie alle Leute, die z.B. Pflanzen domestizieren, haben sie ein empirisches Wissen. Aber dieses Wissen muss man im Zusammenhang mit ihrem Ideengeflecht sehen, ihrer Vorstellung davon, was Pflanzen sind. Man darf das nicht trennen, das gehört zusammen. Es gibt nicht auf der einen Seite die Wissenschaft der Wilden und auf der anderen ihren Aberglauben. Beides gehört zusammen. Genau wie der ontologische Nährboden des Naturalismus untrennbar mit den Wissenschaften verbunden ist, die er ermöglicht hat und umgekehrt. Wir, die wir den Anspruch auf Universalität erheben, haben fälschlicherweise die Vorstellung von der Universalität des Begriffs Natur verbreitet. Man kann umgekehrt also genau dasselbe sagen.“[11]
„Der Kapitalismus ist meiner Meinung nach ein Produkt des Naturalismus, sein soziopolitisches und wirtschaftliches Produkt. Der Naturalismus propagiert die Idee einer Welt, in der jedes Element dem anderen gleicht. Im 18. Jahrhundert geschahen mehrere Dinge: Erstens die Auswirkungen des Kolonialismus. Kleine Länder, und wenn ich klein sage, dann meine ich die Fläche wie z.B. das Vereinigte Königreich, konnten dank ihrer amerikanischen Kolonien massenhaft Waren produzieren, die es ihnen ermöglichten Kapital anzuhäufen und ihre Industrie zu entwickeln. Das wäre mit natürlichen Ressourcen wie den Wäldern, dem Holz, den Weiden oder der Viehzucht nicht möglich gewesen. Der erste Aspekt ist also der Kolonialismus. Der zweite ist eine Bewegung, die bereits Ende des Mittelalters mit dem Eclosure Movement begann: Die Privatisierung von gemeinschaftlich genutztem Land, die im 17. und 18. Jahrhundert beträchtlich zunahm. Diese Privatisierung ging mit der Vorstellung einher, dass der Wert der Dinge von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion entkoppelt werden kann und liberalisierte den Markt für Arbeit und Land. Zwei absolut fundamentale Elemente. Die Vorstellung, dass Geld alles miteinander vergleichbar macht, einschließlich Arbeit und Land, ist in anderen Systemen unvorstellbar. Im Animismus gibt es nicht einmal ein annäherndes Äquivalent von wo etwas. Anthropologen konnten nachweisen, dass es in bestimmten analogistischen Systemen z.B. in Afrika und in gewissen Regionen im Hochland von Südamerika unterschiedliche Kreisläufe gab. Man konnte also Waren einer bestimmten Art nicht gegen Waren einer anderen Art tauschen. Die Waren zirkulierten in geschlossenen Kreisläufen. Doch Geld als allgemeines Äquivalent und der freie Markt für Land und Arbeit haben die Grenzen zwischen den jeweiligen Tauschkreisläufen gesprengt. Das führe zu etwas vollkommen Neuem: Dem industriellen Kapitalismus. Es gibt im Naturalismus bestimmte Elemente, die den industriellen Kapitalismus ermöglicht haben, der in einer animistischen Ordnung undenkbar gewesen wäre.“[12]
Von daher kommt dem Naturalismus auch eine teilweise Verantwortung für unsere Klimakrise zu. „Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Durch die Annahme, dass die Natur von den Menschen getrennt ist, wird sie zu einer Ressource. Entweder zu einer intellektuellen Ressource, als Quelle für Metaphern oder als Idyll, wenn sie vor den Zerstörungen der industriellen Welt bewahrt wurde, oder zu einer Ressource, die man für den eigenen Wohlstand ausbeutet. Man kann davon ausgehen, dass die konzeptuelle Trennung von Natur und Kultur dazu führten, die Umwelt nicht als soziales Anliegen zu sehen, sondern als Lagerstätte für Rohstoffe, die es zu verteilen, sich anzueignen und zu erschließen gilt. Die großen politischen Denker und zwar sowohl die Liberalen im 18. Jahrhundert also auch die sozialistischen im 19. Jahrhundert waren nicht in der Lage, die Tragweite dieser Denkweise zu erfassen, dass die Natur so zu einer unerschöpflichen Ressource wird, aus der man immer mehr Wert schöpfen kann, entweder für das Wohlergehen der gesamten Menschheit oder für das Wohlergehen einiger weniger. Wir werden nun mit dem Ergebnis dieser konzeptuellen Unfähigkeit konfrontiert, die Koppelung der Entwicklung des Wohlstands mit der Entwicklung der Ausbeutung der Natur zu verstehen. Deshalb erfordert die gegenwärtige Situation eine bedeutende intellektuelle Anstrengung, um neue institutionelle Formen des Umgangs mit nichtmenschlichen Wesen zu entwickeln, damit wir der Sackgasse des Naturalismus entkommen.“[13]
Auf diese Weise führt der Naturalismus auch dazu, dass die Vorstellung der Abgrenzung von der Natur die gegenseitigen Abhängigkeiten ausgeblendet. „Wir verstehen diese Abhängigkeiten immer besser. Früher hatten wir eher die Vorstellung, dass Menschen die Herren und Beschützer oder vielmehr die Besitzer der Natur sind. Doch das ist im Grunde dasselbe. Denn man kann nur das beschützen, was man besitzt, was man kontrolliert. Es ist eine Abwandlung des Zitates von Descartes, der 1637 in seinem Bericht über die Methode dazu aufruft, Herren und Besitzer der Natur zu werden; sie ist keine mysteriöse höhere Instanz mehr, sondern ein Raum den es zu erkunden, zu verstehen und zu erobern gilt. Das beruht auf der Unkenntnis der Verbundenheit der Menschen mit allem, was sie umgibt. Wir bestehen z.B. aus Milliarden Bakterien. Die Vorstellung, dass Menschen von nichtmenschlichen Dingen klar unterschieden werden können, ist absurd, denn wir werden zum Teil durch die Wirkung dieser Milliarden nichtmenschlichen Wesen in uns bestimmt. Sie bestimmen unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Lebensweise. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusstwerden. Wir sind zu jedem Zeitpunkt Elemente in Interaktionsketten, durch die jede noch so grundlegende Handlung Auswirkungen auf diese sehr langen Ketten und Rückkoppelungsschleifen hat, die wiederum auf unsere Umwelt und schließlich dann auch auf uns selbst einwirken bzw. auf unsere Überlebensfähigkeit als Spezies.“[14]
Wie konnte es also geschehen, dass wir einen Prozess in Gang gesetzt haben, der die Welt weniger und weniger bewohnbar macht? Und wie können wir diesen Prozess aufhalten? Das fragt sich Philippe Descola und folgert, dass wir die Beziehungen zu unserer Umwelt überdenken müssen, denn „die unbeabsichtigten Folgen unserer Nutzung der Natur gefährden das Gleichgewicht der Ökosysteme, denen wir angehören“[15].