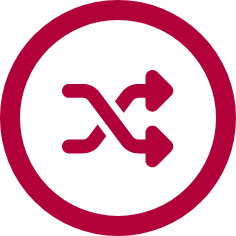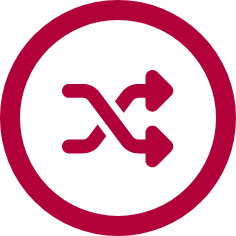
… Ein Druck auf den Button, und die ganze Sache mischt sich neu:
In drei verschiedenen Bereichen werden Materialien einander nach dem Zufallsprinzip zugeordnet und bieten die Möglichkeit, spielerisch online an Predigt und Liturgie zu arbeiten mit Anregungen zum Auftritt, mit Anregungen zum Hören und mit Anregungen für kleine praktische Tätigkeiten.
Lesen
Alles in schlichter Einfachheit. Gehen ist gehen. Ein Buch nehmen ist einfach ein Buch nehmen. Etwas zeigen ist etwas zeigen. Nichts vorführen, nichts besonders langsam. In jeder Geste und Bewegung ihre einfache alltägliche Entsprechung finden. Alles in der schlichten Einfachheit der Schöpfung.
Hören
Jesus Sprach: Seid barmherzig
Ausführen
Zeit heißt Frist. Wer christlich zu denken glaubt und dies ohne Frist zu können glaubt, ist schwachsinnig. (Jacob Taubes)