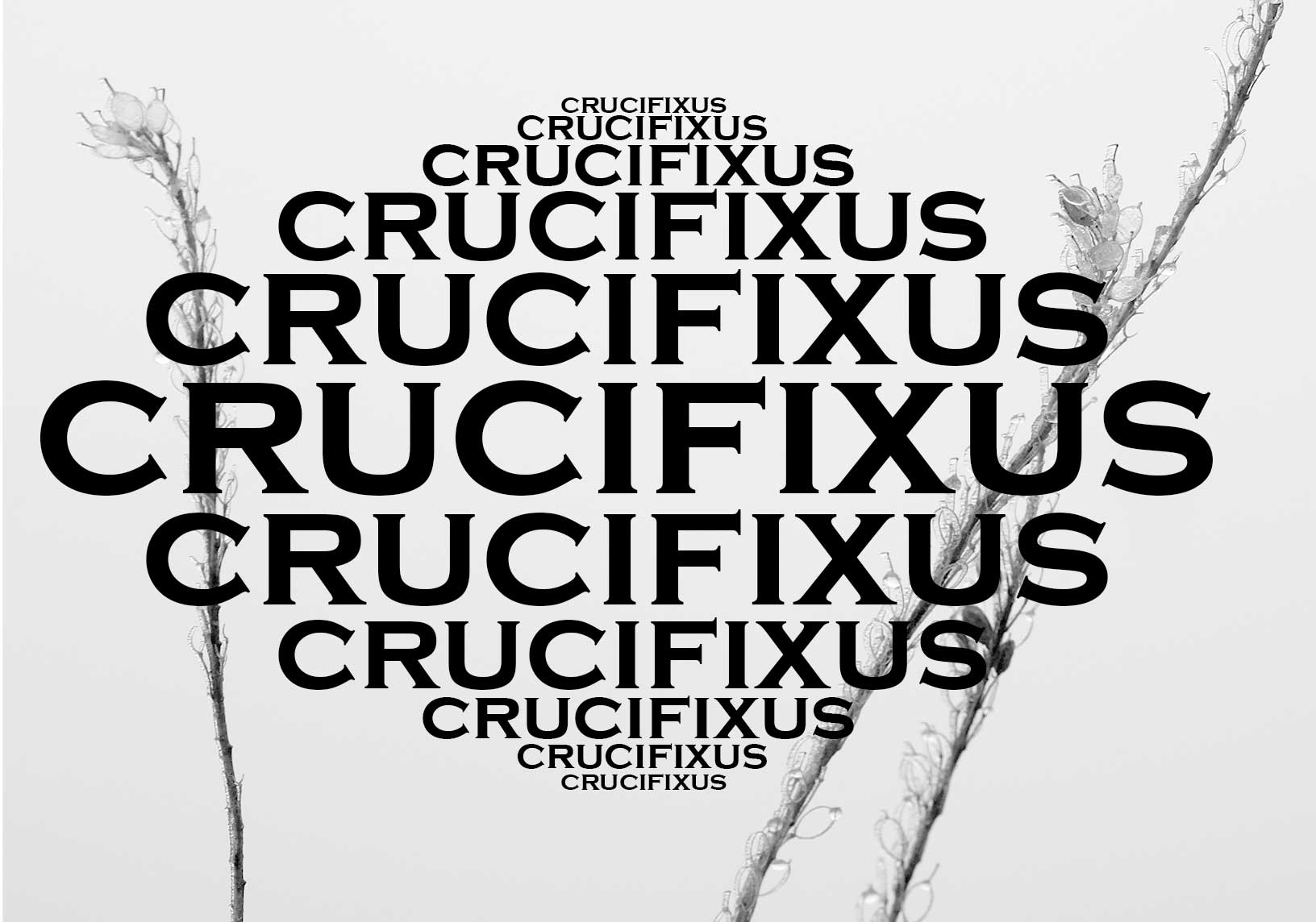Mein Gott! – In seinem Text dieses Titels kommt der französische Philosoph Jean-Luc Nancy auf den Tod Gottes zu sprechen. Während seiner Meditation einer Predigt von Meister Eckhart (Q52) nimmt er die alltägliche rhetorische Praxis des spontanen Ausrufes „Mein Gott!“ auf als „eine kulturelle Ablagerung, ein winziges Überbleibsel der Christenheit, das sich durch die Sprache zieht“1. Sie wird zweifellos immer seltener und Nancy möchte diese Formel keinesfalls mit einem Gewicht versehen, das sie lange verloren hat.
„Aber sie hat es mit Recht verloren, nicht nur weil ‚Gott tot ist‘ (Meister Eckhart sagt es übrigens selbst, ‚Gott ist tot, damit ich der Welt absterbe und allen geschaffenen Dingen‘), sondern weil die Wahrheit von ‚mein Gott!‘ nicht in der Anrufung einer helfenden oder tröstenden Macht oder eines Seins liegt, das im Besitz einer solchen Macht ist.“2
Um das alles bitten wir Gott, wenn wir ihn mit Meister Eckhart bitten, uns von Gott loszulösen, wie in seiner Predigt über die erste Seligpreisung. Doch um zum Kern dieses Ausrufes zu gelangen, müssen wir mit Nancy fortzufahren:
„‘Mein Gott!‘ ist ein Ausruf, der die Tonalität des Erstaunens annehmen kann ebenso wie die des Schreckens, der Bewunderung, der Bedrückung, und er kann sich auch bis zu einer denkerischen Unterbrechung (‚Wer ist Gott? Mein Gott, ich habe keine Ahnung…‘) reduzieren. Ausruf oder Unterbrechung, ‚mein Gott‘ verweist auf ein Unsagbares: nicht auf eine Sprache des Jenseits, aber auf ein Jenseits der Sprache, das die Sprache noch anzeigt.“3
Am Karfreitag gedacht bzw. ausgerufen, ist „Mein Gott!“ das Echo eines Schreis. Wenngleich dieser Schrei eines Sterbenden zwar auch ein Jenseits der Sprache markiert, aber eines, das die Sprache nicht mehr anzeigt.
Der letzte Schrei Christi am Kreuz ist ein reines Performativ, radikaler Entzug. Angezeigt oder besser: übrig bleiben nur noch Konstellationen von Körpern: um das Kreuz herum vereinzelt der erschrockene Hauptmann, wahrscheinlich einige Soldaten, etwas entfernt trauernde Frauen, auch zuschauende Bekannte; Jesu Mutter Maria, sein Jünger Johannes nah beieinander, auch bei ihnen Maria Magdalena und die andere Maria, Klopas‘ Frau, letztere in Hörnähe. Diese Konstellationen sind in den evangelischen Erzählungen beschrieben, skizziert als kleine Szenen, die aus dem Vorgegangenen übriggeblieben sind. Sie wurden oft und unterschiedlich bildlich dargestellt.
Der Schrei am Kreuz bildet den performativen Kern dieser Szenen und ihnen folgend der christlichen Liturgie des Karfreitages. Doch liturgisch ist der Schrei verstummt. Aber auch liturgisch bleiben Körper übrig, ob sie erschrocken vereinzelt verharren, mit etwas Abstand trauern, allein Weinen, sich gegenseitig trösten, in den Arm nehmen, Beten …
Derartige Ansammlungen von Körpern, in kleine Szenen skizziert, kondensieren zu liturgischen Formen, wandern in Liturgie ein, wenn, wie etwa bei einem Gebet um das Kreuz, wie es in Taizé aus einer orthodoxen Tradition heraus entwickelt wurde, ein Kreuz auf den Boden gelegt wird und die Menschen hingehen, die Stirn auf das Holz des Kreuzes legen und durch ein Gebet mit dem Körper die eigenen Lasten und die der anderen in Gott versenken.
Vor diesem Hintergrund lässt sich die tabubrechende Referenz für den Tod Gottes am Karfreitag lesen. Auch sie ist eine Szene; allerdings scheint sie wieder aus der Liturgie ausgewandert und an jedem Ort der Welt vorstellbar. Ihre ins Tragische ragende Dramatik erlangt sie auf den Schlachtfeldern Europas und der Welt:
„Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« – Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verlorengegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? – so schrien und lachten sie durcheinander.
Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er, »ich will es euch Sagen! Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unsern Messern verblutet – wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat – und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!« – Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, daß sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann, »ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert – es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehn und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne – und doch haben sie dieselbe getan!« – Man erzählt noch, daß der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe.
Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet: »Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? »“4
Auf den Schlachtfeldern wird auch der Schrei wieder hörbar, dessen Echo dieser Ausruf ist: „Mein Gott!“