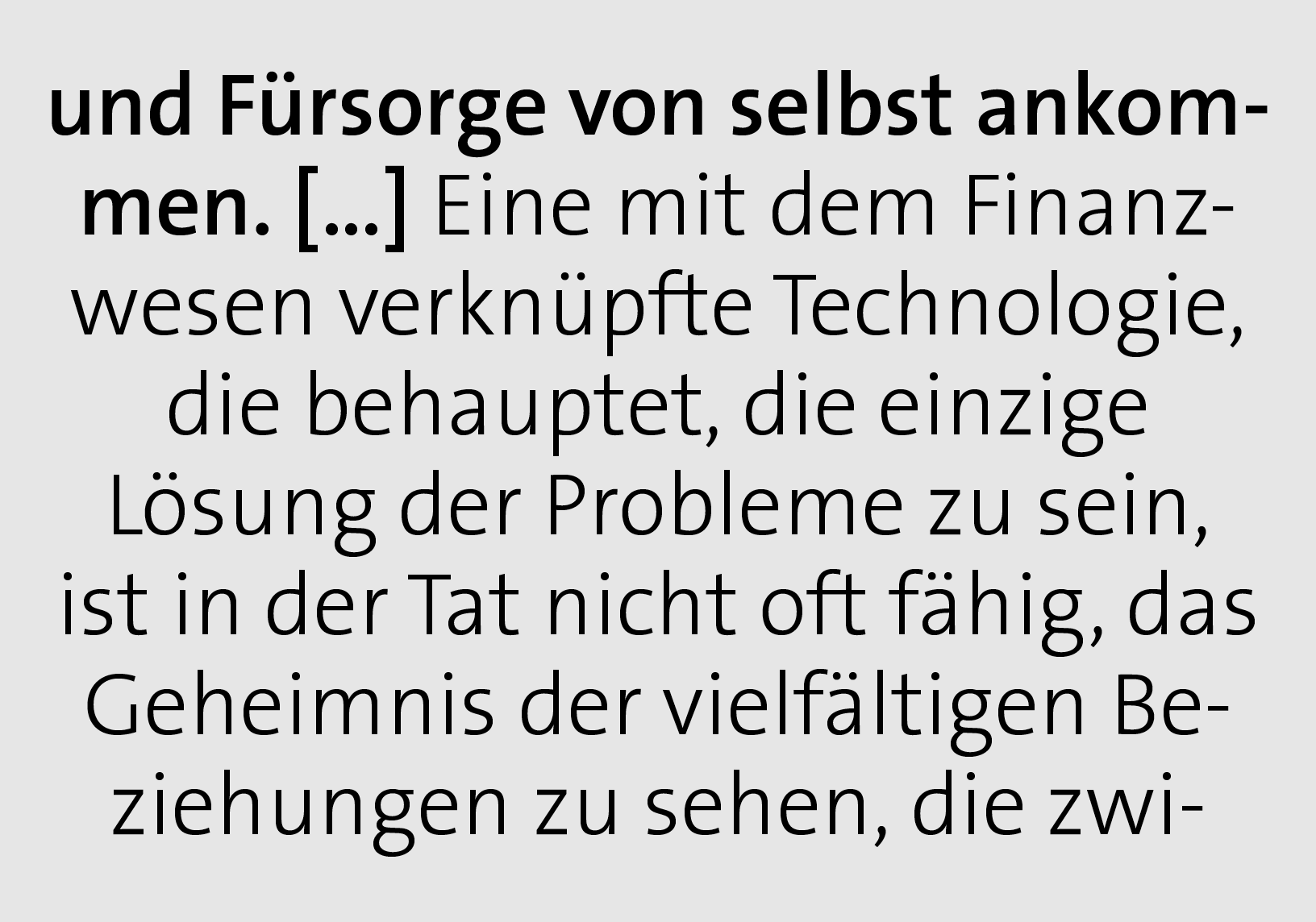„Das, was sie Natur nennen, bedeutet in unserer sehr alten Sprache urihi a, Wald-Erde, aber auch ihr nur für die Schamanen sichtbares Bild, das wir Urihinari nennen, den Geist des Waldes. Ihm verdanken wir, dass die Bäume lebendig sind. Was wir also als Geist des Waldes bezeichnen, sind die unzähligen Bilder der Bäume, der Blätter, ihrem Haar, und der Lianen. Es sind auch die Bilder des Wildes und der Fische, der Bienen, der Schildkröten, der Eidechsen, der Regewürmer und sogar die [abstoßenden] Schnecken, warama aka. Das Bild des Fruchtbarkeitswerts Ne roperi des Waldes, ist ebenfalls das, was die Weißen Natur nennen. Es wurde mit ihm erschaffen und verleiht ihm seinen Reichtum. Somit sind für uns die xapiri– Geister die wahren Besitzer der Natur und nicht die Menschen. […] Die xapiri empfinden Freundschaft für den Wald, weil er ihnen gehört und weil er sie glücklich macht. Die Weißen finden die Natur schön, ohne zu wissen, warum. Wir wissen, die Natur, das sind ebenso der Wald wie auch all die xapiri, die ihn bewohnen. […]“[1]
„Omama [2] war von Anbeginn der Zeit an das Zentrum dessen, was die Weißen ‚Ökologie‘ nennen. Das ist wahr! Lange bevor diese Worte bei ihnen existierten und sie anfingen, so viel darüber zu reden, waren sie schon in unserem Innern, ohne dass wir sie auf dieselbe Weise benannten. Seit jeher waren sie für die Schamanen Worte, die von den Geistern kamen, um den Wald zu verteidigen. Wenn wir Bücher besäßen, so wie sie, dann könnten die Weißen feststellen, wie alt diese Worte wirklich sind! Im Wald sind wir, die Menschen, die Ökologie! Aber genauso wie wir sind die xapiri, das Wild, die Bäume, die Flüsse, die Fische, der Himmel, der Regen, der Wind und die Sonne Ökologie! Sie umfasst alles, was im Wald ins Dasein gelangt ist, weit weg von den Weißen, alles, was noch nicht von Zäunen eingeschlossen ist. Die Worte der Ökologie, das sind unsere alten Worte, jene die Omama unseren Vorfahren gegeben hat. Die xapiri verteidigen den Wald seit er existiert. Und weil sie sie besitzen und an ihrer Seite haben, haben unsere Vorfahren den Wald nie verwüstet. Ist der Wald nicht immer noch so lebendig? Die Weißen, die früher von all diesen Dingen nichts wussten, fangen jetzt an, sie zu Hören. Deshalb haben einige von ihnen neue Worte erfunden, um den Wald zu schützen. Sie nennen sich jetzt ‚Leute der Ökologie‘, denn sie sind in Sorge, dass ihr Land, ihre Erde immer heißer wird.
Unsere Vorfahren haben nicht daran gedacht, den Wald zu roden oder die Erde im Übermaß umzugraben. Sie dachten einfach, dass der Wald schön war und dass er für immer so bleiben sollte wie er war. Die Worte der Ökologie bedeuteten für sie, daran festzuhalten, dass Omama den Wald geschaffen hatte, damit die Menschen darin leben konnten, ohne ihn zu misshandeln. Das ist alles. Wir sind die Bewohner des Waldes. Wir wurden im Zentrum der Ökologie geboren und sind dort aufgewachsen. Wir haben ihre Stimme schon immer gehört, denn es ist die Stimme der xapiri, die von den Bergen und Hügeln herabsteigen. Deshalb haben wir, als diese neuen Worte der Weißen zu uns gelangten, sie sogleich verstanden Ich erklärte sich meinen Leuten und sie dachten: ‚Heixopë! Das ist gut! Die Weißen nennen diese Dinge Ökologie! Wir Sagen dazu urihi a, Wald, und wir sprechen auch von den xapiri, denn ohne sie, ohne Ökologie, erhitzt sich die Erde und lässt die Seuchen von unheilvollen Wesen herankommen!‘
Früher konnten unsere Ältesten den Weißen ihre Worte über den Wald nicht vermitteln, weil sie ihre Sprache nicht beherrschten. Und als die ersten Weißen bei Ihnen auftauchten, sprachen sie auch noch nicht von Ökologie! Stattdessen wollten sie von Ihnen Jaguar-, Pekari- und Rehfelle haben. Damals besaßen sie noch keine dieser Worte, die den Wald schützen sollten. Es ist noch nicht lange her, dass solche Worte in ihren Städten auftauchten. Sie müssen sich schließlich gesagt haben: ‚Hou! Wir haben unser Land und unsere Flüsse verschmutzt, und unser Wald wird immer kahler! Wir müssen das Wenig, was uns noch bleibt unter dem Namen Ökologie schützen!‘ Ich denke, sie haben Angst bekommen, weil sie die Orte, an denen sie leben, derart verwüstet haben. Anfangs, als ich noch sehr jung war, habe ich die Weißen nie darüber sprechen hören, die Natur zu schützen. […]“[3]
Sobald die Rede der Ökologie in den Städten aufkam, konnten unsere Worte über den Wald dort auch Gehör finden. Die Weißen begannen, mir zuzuhören und sich zu sagen: ‚Haixopë! Es stimmt also, die Vorfahren der Waldbewohner besaßen die Ökologie schon!‘ […] So war es. Unsere Vorfahren kannten die Worte der xapiri, aber nicht jene der Ökologie, die die Weißen sehr viel später für sich allein und weit weg von uns, geschaffen haben. Auch ich hatte sie nie gehört, als ich jung war. Aber da die Geister die Ökologie kannten, ehe die Weißen ihr diesen Namen gaben, habe ich die neuen Worte schnell verstanden, denn unsere alten Schamanen wissen diese Worte seit jeher. […]“[4]
„Wenn sie vom Wald sprechen, benutzen die Weißen oder noch ein anderes Wort, nämlich ‚natürliche Umwelt‘. Dieses Wort stammt ebenfalls nicht von uns, und bis vor Kurzem war es uns noch unbekannt. Für uns ist das, was die Weißen damit benennen, das, was von der Erde und dem Wald übrigbleibt, wenn die Maschinen ihn beschädigt haben. Es ist das Überbleibsel von allem, was sie bisher zerstört haben. Ich mag dieses Wort ‚Umwelt‘ nicht. Die Erde darf nicht durch die Umwelt zerschnitten werden. Wir sind die Bewohner des Waldes, und wenn man ihn auf diese Weise unterteilt, wissen wir, dass wir mit ihm Sterben werden. Ich ziehe es vor, dass die Weißen von der ‚Natur‘ oder ‚Ökologie‘ als Ganzem sprechen. Wenn man ihn zurechtschneidet, um kleine Parzelle davon zu beschützen, die nur der Überrest dessen sind, was verwüstet wurde, kann das nichts Gutes ergeben. Mit einem Rest von Bäumen und einem Rest der Wasserläufe, einem Rest vom Wild, von Fischen, von Menschen, die dort leben können, wird sein Lebensatem zu kurz werden. Darum sind wir so besorgt. […] Bei sich haben die Weißen den Wald schon beinahe vollständig zerstört. Es sind nur noch ein paar Teilstücke übrig, die sie mit Zäunen umschlossen haben. Ich glaube, sie haben nun vor, das Gleiche mit unserem Wald zu tun. Das macht uns traurig und besorgt.“[5]
***
P.S. in seiner Lektüre der Enzyklika „Laudato si‘“ kommt der brasilianische Anthropologe Edouardo Viveiros de Castro (Eintrag in diesem Blog vom 2. Juli 2025) auf den brasilianischen Yanomamii-Schamanen, Indigenen-Aktivisten und Träger des Alternativen Nobelpreises von 2010 zurück. Seine im Gespräch mit dem französischen Anthropologen Bruce Albert herausgegebenen autobiographischen Schriften mit dem Titel „Der Sturz des Himmels“ stehen nach Viveiros de Castro einem Werk wie „Traurigen Tropen“ von Claude Lévi-Strauss aus dem Jahre 1955 in nichts nach. Im Zusammenhang seiner Lektüre bezeichnet er diese Schriften als einen „prophetischen Diskurs über ‚die ökologische Schuld‘ der Weißen“.
Die ausgewählten Ausschnitte des Textes stehen in der Reihe der Blogeinträge als Gegenstimme und soll als solche erst einmal unkommentiert gelesen werden im Sinne einer „multinaturalistischen Gegenanthropologie“ (Viveiros de Castro) oder einer „historischen Gegenanthropologie zur Welt der Weißen“ (Bruce Albert) oder im Sinne einer „symmetrischen Anthropologie“ (Bruno Latour), also verschiedener Konzepte, und so eine Anthropologie aus der Perspektive der Anderen zuzulassen. Zur Einordnung der Schrift sei auf das Vorwort von Viveiros de Castro zu deutschen Ausgabe, a.a.O., S. 13-46 hingewiesen.
***
Zum von David Kopenawa erwähnten Begriff „Umwelt“ liest sich folgender Abschnitt wie ein Verbindungsglied zur Gaia-Diskussion, die in den Blogeinträgen zu verschiedenen Lektüren von „Laudato si“ bewusst etwas in den Hintergrund gestellt wurde: „Die von Latour benutzten oder besser: produktiv aufgenommenen Ausdrücke Gaia (nach James Lovelock) und critical zone (nach Gil Ashley und Jérôme Gaillardet) mögen fürs erste ungewöhnlich, sogar mythologisch oder vage übergeographisch klingen. Ihre Bedeutung verdient Aufmerksamkeit bei allen, die die wachsende Sorge um das herkömmlich sogenannte Verhältnis von ‚Mensch und Umwelt‘ durch ein mitwachsendes Bewusstsein von der planetarischen, vormals: irdischen Hausgemeinschaft allen Lebens teilen. Die beiden Ausdrücke, der mythologische wie der ökogeologische, treten in Konkurrenz zu dem anfangs biologisch oder metabiologisch konzipierten, dann sozioökonomisch und politisch gewendeten Begriff ‚Umwelt‘: Ja, sie decken, auf diskrete unpolemische Weise, das ideologische Design des Umweltgedankens auf, wonach jedem Um aus der Sicht industriegesellschaftlicher Selbstverwirklichungsprojekte als eine ‚Ressource‘ oder als Hinweis auf eine solche aufzufassen sei. Mithin, was in die ‚Umwelt‘ des Menschen fällt, gilt fürs erste als ein Inbegriff von Verwertbarkeiten und von Aspekten derselben. Umweltschonung wird auf dieser Linie vor allem als Ressourcenschonung vorgestellt. Dem Konzept ‚Umwelt‘ in seinem nivellierenden Gebrauch ist der Vorwurf zu machen, es missbraucht den darin enthaltenen Ausdruck ‚Welt‘, um die Hinordnung aller Dinge auf die befehlende, produzierende und konsumierende industriesystemische Mitte zu bekräftigen. Das Um von Umwelt bezeichnet einen Ring aus ‚Umständen‘, von denen das Dasein sich um-‚geben‘ glaubt, und von Ressourcen, die in den Radius von anthropozentrischen und industriellen Verwertungspraktiken fallen. Dann wäre das Weltganze ein Lieferservice im Dienst der Firma ‚Macht Euch die Erde untertan‘.[6] Wer von Umwelt spricht, muss sich fragen lassen, ob damit ein schonend anerkennendes Verhältnis der Einwohner zu ihrem Mitlebensraum gemeint ist – oder ob Umwelt nur eine Chiffre für die Einsaugung von allem Gegebenen ringsum in das schwarze Loch des Zentralprozesses darstellt.
Ein philosophisch besonnener Begriff der Welt hätte diese als Inbegriff der Offenheit aufzufassen – einer Verbindlichkeit fordernden Offenheit, sprich: eines Immersionsraums, in dem wir, ekstatisch eintauchend, in eine Lage geraten, aus der die Gegenstände der Sorge und der Empörung auf uns zu treten, ebenso wie die Anblicke des Schönen oder Erhabenen, die Blitzschläge des Erkennens und die gemeinsamen Fabrikationen des Wahren sowie die Forderungen der Gerechtigkeit. Wer Gaia sagt oder den Ausdruck critical zone verwendet, verzichtet auf die Illusion der ontologischen Distanz. Damit wird ohne weitere Ausrede klar: Das seit 1927 philosophisch so bezeichnete In-der-Welt-Sein[7] ist entweder eine hohle Formel, oder es bedeutet: Auf-Gaia-Sein und Dasein in der sensiblen Zone.“[8]
***
Zum Thema „Wald“, wie es im Mittelpunkt der ausgewählten Ausschnitte aus „Der Sturz des Himmels“ steht, seien weiterhin das Buch des Kanadischen Anthropologen Edouardo Kohn mit dem Titel „Wie Wälder Denken. Anthropologie jenseits des Menschlichen“ (Berlin 2023), aus einem anderen geographischen Teil der Erde die Bücher „An das Wild glauben“ (Berlin 2021) und „Im Osten der Träume“ (Berlin 2024) der französischen Anthropologin Nastassja Martin empfohlen, sowie das Buch „Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen“ (München 2018) des italienischen Philosophen Emanuele Coccia und der Film „Das Geheimnis der Bäume“ mit dem französischen Botaniker Francis Hallé (Regie Luc Jacquet, 2013, in der deutschen Fassung erzählt von Bruno Ganz als DVD erschienen 2014, Weltkino/ Arthaus).
***
Und zuletzt: Immer wieder entflammt die Diskussion um die historische Zuverlässigkeit von Quellen wie der von David Kopenawa (auf die schon der Titel dieses Beitrags hinweist) bzw. die Frage nach ihrer Literarizität und ihren Auswirkungen auf das sogenannte westliche Denken. Diese Fragestellung wird ausführlich diskutiert in: David Graeber, David Wengrow, Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit, Stuttgart 2022, 2024, im Kapitel „Sündhafte Freiheit. Indigene Kritik und Fortschrittsmythos“ (S. 41-94) und im Kapitel „Der Kreis schließt sich. Über die historischen Grundlagen indigener Kritik“ (S. 471-524).