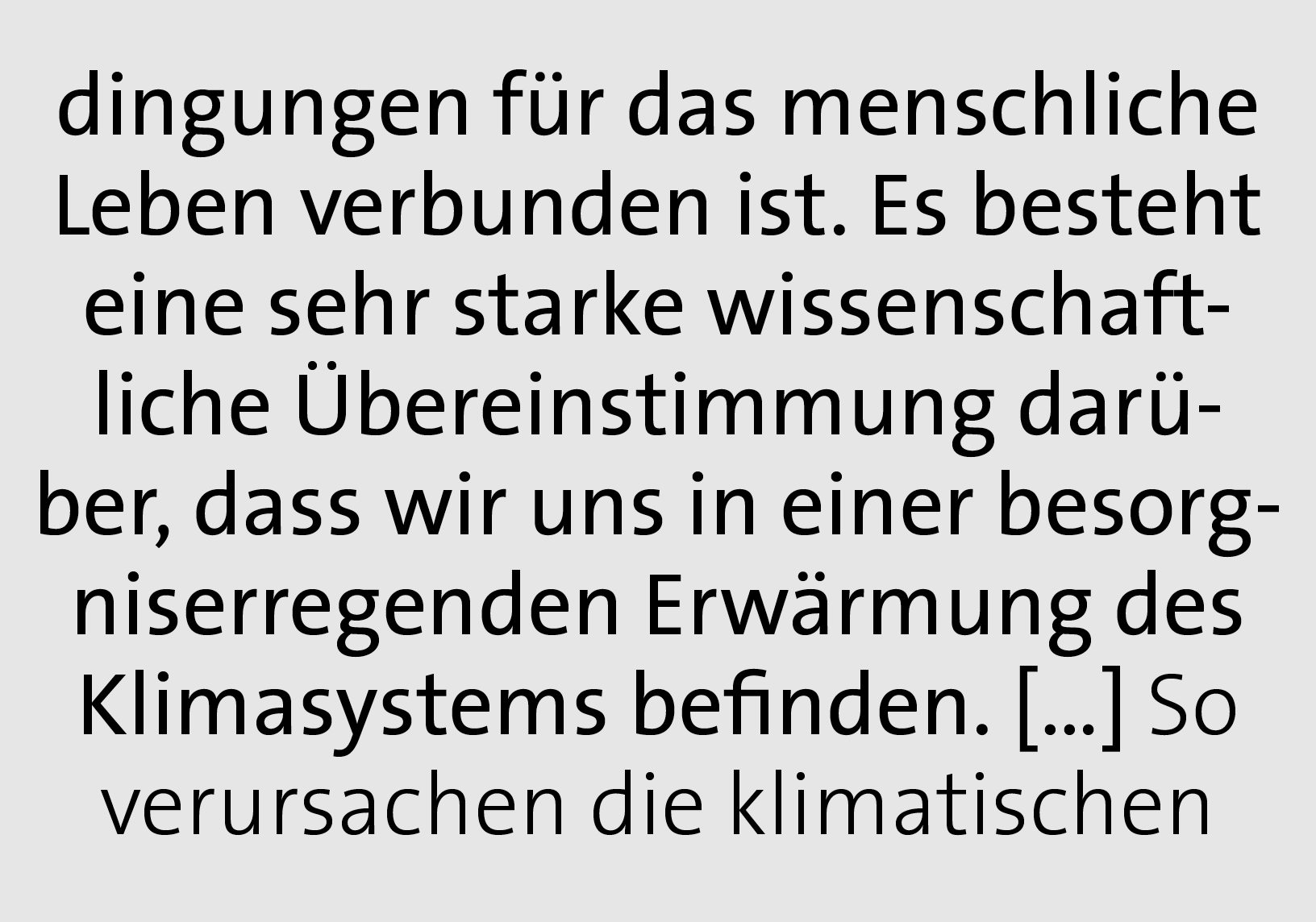Wenn der brasilianische Anthropologe Edouardo Viveiros de Castro die größte Herausforderung für die christliche Theologie angesichts des Klimawandels in der Frage danach zuspitzt, ob sie den Animismus reaktivieren könnte, so ist dies nur auf den allererste und flüchtigen Bick eine Provokation, die ans Unvorstellbare grenzt.
Warum also ausgerechnet Animismus? Oder – mit den Worten de Castros – warum das, „was man in schlechter Gewohnheit Animismus nannte“[1]?
Als der französische Anthropologe Philippe Descola zu Beginn seiner Studien bei den Achuar im Amazonas seine Beobachtungen machte und aufzeichnete, wunderte er sich darüber, dass sie mit den Tieren und Pflanzen sprachen. Sie gingen mit ihnen um wie mit Personen. Und er stellte fest, dass sich die Lebenswirklichkeit dieser Menschen erheblich anders darstellte, als die seine. Noch immer kommt dieser Unterschied sehr deutlich zum Ausdruck in der Geschichte, die Claude Levi-Strauss aus der Zeit der Reformation überliefert, als die spanischen Eroberer herausfinden sollten, ob die sogenannten Eingeborenen eine Seele hätten. Für sie war unausgesprochen und fraglos klar, dass sie ebenso wie die Tiere einen Körper hätten, aber eine Seele? Für die Indigenen hingegen stellte sich heraus, dass sie sich die Frage genau andersherum stellten. Eine Seele müssten die weißen Ankömmlinge, was immer sie seien, haben, denn Tiere, Totengeister und Götter haben eine Seele. Ob sie aber einen Körper hätten? Die durchgehende Ordnung ist bei den Indigenen durch die Seele bestimmt, die Körper konnten sehr verschieden sein, wie bei Tieren, Totengeistern oder Göttern. Für die vom Christentum geprägten Fremden hingegen, war die Ordnung durch die Körper gestiftet.
Derartige Beobachtungen und vergleiche mit entsprechenden aber auch anderen Beobachtungen lassen Philippe Descola verschiedene Weltverhältnisse bestimmen: „Die von der Kombination von Interiorität und Physikalität zulässigen Formeln sind sehr begrenzt: gegenüber einem beliebigen Anderen, ob Mensch oder Nichtmensch, kann ich vermuten, dass er entweder Elemente von Physikalität und Interiorität besitzt, die mit den meinen identisch sind, oder dass seine Interiorität und seine Physikalität von den meinen abweichen, oder auch, dass wir gleichartige Interioritäten und verschiedenartige Physikalitäten haben, oder schließlich, dass unsere Interioritäten verschieden sind und unsere Physikalitäten gleich sind. Die erste Kombination werde ich ‚Totemismus‘ nenne, ‚Analogismus‘ die zweite, ‚Animismus‘ die dritte und ‚Naturalismus‘ die letzte.“[2]
Diese Typen von Weltverhältnissen sind bei Philippe Descola nicht nur verschiedene Arten und Weisen, sich die Welt vorzustellen oder zu repräsentieren, die unabhängig davon universell gleich ist, sondern sie sind Seinsweisen: „Diese Identifikationsprinzipien definieren vier große Ontologietypen, das heißt Systeme von Eigenschaften der Existierenden, die kontrastierenden Kosmologieformen, Modelle des Sozialen Bandes und Theorien der Identität und der Andersheit als Ankerpunkt dienen.“[3]
Animismus meint also das Weltverhältnis der Indigenen, von denen die o.g. Geschichte berichtete: gleichartige Interioritäten, also subjektiv-moralische Innerlichkeiten, und verschiedene Physikalitäten, also Körperlichkeiten. Kurz gesagt: wenn ich einem Anderen, gleich ob Mensch oder Nichtmensch begegne, gehe ich davon aus, dass seine Innerlichkeit der meinen gleicht, auch wenn die Körper verschieden sind, und gehe auch so mit ihm um, also wie mit Personen, zu denen ich sprechen, mit denen ich interagieren und verschiedene Arten von Beziehungen unterhalten kann.
Um die von ihm beobachteten Phänomene zu beschreiben, ging Philippe Descola bewusst auf den aus dem Ende des 19. Jahrhundert stammenden Begriff des Animismus zurück und hat ihn rehabilitiert: „Sowohl aus Abneigung gegen Neologismen als auch um mich nach einer Praxis zu richten, die ebenso alt ist, wie die Anthropologie selbst, habe ich mich dafür entschieden, bereits eingeführte Begriffe zu verwenden und ihnen eine neue Bedeutung zu geben. Aber dieser ehrwürdige Gebrauch kann zu Missverständnissen führen […].“[4]
Schließlich kommt Descola zu folgender Definition: „Wenn man die Definition des Animismus ihrer soziologischen Korrelate entkleidet, bleibt ein Merkmal, über das alle Welt Einigkeit erzielen kann und das die Etymologie des Terminus sichtbar macht, ein Grund, warum ich mich entschieden habe, ihn trotz seiner früher anfechtbaren Verwendungen beizubehalten: nämlich, dass Menschen einigen Nichtmenschen eine mit der ihren identische Interiorität zuerkennen. Diese Disposition vermenschlicht die Pflanzen und vor allem die Tiere, da die Seele, mit der sie versehen sind, ihnen nicht nur erlaubt, sich gemäß den sozialen Normen und den ethischen Vorschriften zu verhalten, sondern auch mit letzteren sowie untereinander Kommunikationsbeziehungen herzustellen. Die Ähnlichkeit der Interioritäten erlaubt also eine Ausdehnung des Stands der ‚Kultur‘ auf die Nichtmenschen mit allen Attributen, die dies impliziert, von der Intersubjektivität bis hin zur Beherrschung der Techniken über die ritualisierten Verhaltensweisen und die Beachtung der Konventionen. Allerdings ist die Vermenschlichung nicht vollständig, denn in den animistischen Systemen unterscheidet sich diese Art verkleideter Menschen wie sie die Pflanzen und Tiere darstellen, von den Menschen durch ihr Gewand aus Federn, Fell, Schuppen oder Rinde, anders gesagt: durch ihre Physikalität.“[5] Die Unterscheide bestehen also in den Formen, Verhaltens- und Lebensweisen.
Dieser Definition des Animismus folgend fügt Edouardo Viveiros de Castro noch einen Aspekt, den er Perspektivismus nennt, hinzu: „Die Menschen sehen normalerweise die Menschen als Menschen, die Tiere als Tiere und die Geister (falls sie sie sehen) als Geister; die (räuberischen) Tiere und die Geister sehen die Menschen als Tiere (Beute), während die Tiere (das Wild) die Menschen als Geister oder als (räuberische) Tiere sehen. Demgegenüber sehen die Tiere und die Geister sich selbst als Menschen, sie nehmen sich als anthropomorph (oder so werdend) wahr, wenn sie in ihren eigenen Häusern oder Dörfern sind, und leben ihre eigenen Bräuche und Merkmale in den Gestalten der Kultur […].“[6]
Sollen wir nun alle Animisten oder besser „Neo-Animisten“ werden, wie Philippe Descola in einem Porträt-Film gefragt wird? Er hält das für nur schwerlich möglich, denn historische Situationen sind nicht einfach übertragbar. „Man müsste vielmehr an institutionellen Veränderungen arbeiten, z.B. Lebensräumen eine Rechtspersönlichkeit geben, das wäre ein interessanter Ansatz.“[7]
Kann man vor diesem Hintergrund den Sonnengesang des Franz von Assisi als einen Versuch ansehen, den dort angesprochenen nichtmenschlichen Wesen eine liturgisch ansprechbare Persönlichkeit zu geben?
Bruno Latour hatte sich jedenfalls davon ermutigen lassen…